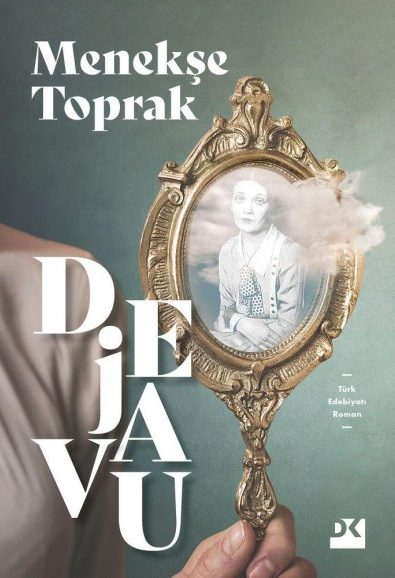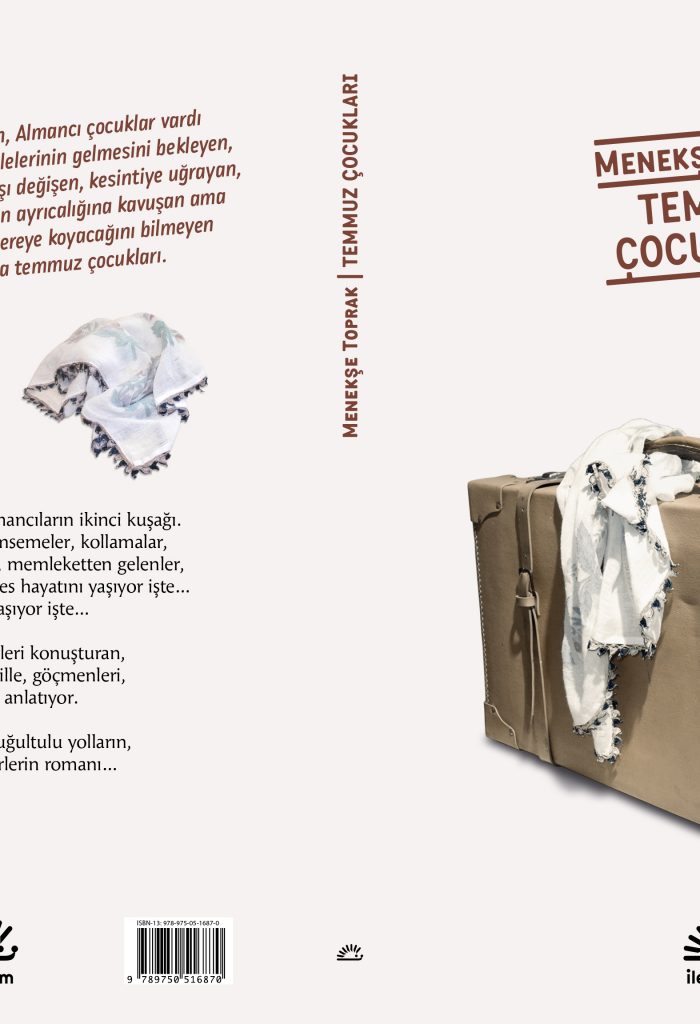Berlin 2019 Teil 2
Ich erinnere mich noch, wie ich hier ankam. Es war Nacht, und sehr warm, so warm, als wäre ich nicht in einer herbstlichen Stadt Mitteleuropas, sondern in einem hochsommerlichen Land des Südens. Als ich mit meinen schweren Koffern, in Jeans und Wolljacke in der Pension eintraf, war ich durch und durch nassgeschwitzt, und in gleichem Maße erschüttert. Und das lag nicht allein an dieser gnadenlosen Hitze. Schon auf den ersten Blick war zu erkennen, dass es sich bei der Unterkunft, die ich über das Internet gebucht hatte, um ein Stundenhotel, eine Art Bordell handelte. Prostitution hatte ich in Filmen gesehen, und hautnah zumeist auf meinem Nachhauseweg von Taksim mitbekommen, wo Frauen, darunter viele Transvestiten, in den dunklen Ecken von Elmadağ auf Kunden warteten und mit ihnen feilschten. In dieser Pension nun begegnete mir das Gewerbe in all seinen Klischees: Zwei zwielichtige Typen mit nach hinten gekämmtem, gegeltem Haar, und zwei Frauen in glitzernden Miniröcken tranken an der Bar neben der Rezeption Alkohol, musterten mich, unter Beteiligung des Rezeptionisten, so als taxierten sie meine weiblichen Qualitäten, dabei unterhielten sich miteinander, vermutlich auf Russisch, und lachten. Wäre ich eine Künstlerin, die aus solch kuriosen Begegnungen Inspiration zu schöpfen wüsste, hätte ich all das in dieser mir neuen, für so Allerhand berühmten und aufgeschossenen Stadt, die ich aber nicht zuallererst mit Prostitution assoziiert hätte, bestimmt unter dem Kapitel „Lebenserfahrung“ verbucht.
Ich jedoch entschied mich dafür, meine Brille von eineinhalb Dioptrien aus der Tasche zu ziehen und sie mir zum Schutz auf die Nase zu setzen, mich also sozusagen dahinter zu verstecken. Dabei ging mir eigentlich ein Satz im Kopf um, den mir mal jemand direkt ins Gesicht gesagt hatte, und über den wir viel diskutiert und gelacht hatten: „Du bist jung, du hast eine Vagina, also kein Grund, dir Sorgen zu machen!“ Der Vorfall war zwar schon sehr lange her, und Vorfall ist eigentlich schon zu viel gesagt, aber er ließ uns eine ganze Weile nicht mehr los. Mit uns meine ich mich und Serap, eine frühere gute Freundin von mir. Serap war Mathematiklehrerin, wir arbeiteten am gleichen Nachhilfeinstitut, und als man damals das Institut schloss, wurden wir arbeitslos; wenigstens Serap hatte kaum eine Woche später wieder eine Stelle als Lehrkraft in einer Privatschule. Irgendwann saßen wir mal zusammen in einer Kneipe in Beyoğlu. Ich trank, und während ich so vor mich hin trank, brachte ich nach und nach meinen ganzen Frust auf den Tisch. Ich war erst sechsundzwanzig, aber sowohl in Sachen Liebe, als auch in beruflicher Hinsicht steckte ich in einer Sackgasse. Beim Thema Männer hatte ich, wie stets, einen Fehlgriff getan, ich geriet immerzu an den Falschen, ließ es zu viel nah an mich heran, aber ärgerte mich deswegen auch sehr über mich selbst. Sogar meine Mutter hatte mich schon vor ein paar Jahren im Stich gelassen, dadurch, dass sie zu meiner jüngeren Schwester zog. Wer weiß, beim wievielten Bier ich gerade war, stockbesoffen jedenfalls, da hatte ich schließlich all meinen Kummer beisammen und heulte los. Das war noch zu den Zeiten, als sich in Beyoğlu die Leute auf die Füße traten. Wir saßen im Freien, viel Lärm, viel Gedränge. Da beugte sich eine Frau in ziemlich fortgeschrittenem Alter urplötzlich aus der Menge über unseren Tisch, fragte, warum ich weinte, und Serap erklärte ihr, dass ich meine Arbeit verloren hatte. Ich war baff, was die Frau daraufhin von sich gab: „Das ist doch kein Grund zum Weinen? Mach dir keine Sorgen, du bist jung, du hast eine Vagina!“
Habe ich damals gelacht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dieser Ausspruch schlug so bei uns ein, dass er uns noch tagelang beschäftigte. Wenn ich so im Nachhinein daran denke, war es nicht nur dieser Satz, der uns nicht mehr losließ, es war auch die Frau selbst, die wie ein Traum, wie ein Spuk unvermittelt vor uns aufgetaucht und wieder verschwunden war. Es war, soweit ich mich erinnere, eine ziemlich alte Frau mit Kurzhaarfrisur, beigefarbener Bluse, Schal und verrunzeltem Hals, so gepflegt und schlicht, wie ich mir eine Akademikerin vorstellte. Meine Freundin behauptete, sie sei eine Künstlerin, sogar eine in Bedeutungslosigkeit versunkene Yeşilcam-Schauspielerin. Dann änderten wir unsere Meinung und sie war nichts weiter als eine weise Frau. Und das, was sie gesagt hatte, war ironisch gemeint, um uns die Macht von Weiblichkeit und Jugend zu verdeutlichen. Vielleicht war sie sogar eine Dichterin. Später, warum weiß ich nicht mehr, überlegten wir es uns wieder anders und machten sie zu einem alten Transsexuellen, der gar keine Vagina besitzen konnte, dann zu einer Nymphomanin, die ihre Begierden nicht wie gewollt ausleben konnte, und schließlich war sie eine ehemalige Lebedame, die wusste, wie aus dem Körper Kapital zu schlagen war. Damals, als ich meinen Hochschulabschluss in der Tasche hatte, wollte ich die Romane aus osmanischer Zeit bis hin zum zeitgenössischen türkischen Roman nach dem Auftreten von Prostituierten durchsuchen und spielte sogar mit dem Gedanken, zu diesem Thema zu promovieren. Serap, für die sich die Literatur nur aus Bestsellerlisten und Weltklassikern zusammensetzte, fragte: „Tauchen denn da so viele davon auf?“, und ich zählte ihr einen ganzen Schwung von Huren aus türkischen Romanen auf.
Aber sie pickte sich gleich wieder die bekannteste aus meiner Aufzählung heraus und empörte sich: „Also, die Maria Puder aus Sabahattin Alis Die Madonna im Pelzmantel habe ich nie als leichtes Mädchen begriffen“. Die phosphoreszierende Cevriye hatte sie nicht gelesen, aber den Film gesehen; und das Mädchen im Film war ihrer Meinung mit Sicherheit kein Flittchen.
Das war auch egal. Ich war ohnehin nicht mutig genug, mich in meiner Doktorarbeit mit Huren in der Literatur zu befassen. Wer wäre schon so abgebrüht, sich mir nichts dir nichts in diesen Sumpf zu begeben? Ich verbrachte mehrere Wochen mit dem Thema, hatte mich sogar schon für den Titel Kurtisanen als Romanheldinnen in den frühen Jahren der Republik entschieden, am Ende aber beschlossen, statt über Frauen, die mit Sexarbeit ihr Geld verdienten, über Autorinnen zu forschen, die Romane über solche Frauen schrieben. Manchmal denke ich mir, diese geheimnisvolle Alte, die damals an unseren Tisch kam und uns diesen überwältigenden Satz zuraunte, war wohl auch einer der Gründe für meine Entscheidung, hierherzukommen. Und es stimmt ja auch, hätte uns diese Frau nicht so gefesselt, hätte ich mich bestimmt nicht mit dem Thema „Prostituierte im türkischen Roman“ befasst und wäre nie den Spuren einer Frau bis nach Berlin gefolgt, die sich vor hundert Jahren in einer Stadt wie dieser mit dem Schreiben über Wasser halten und es wagen konnte, in die Welt der Prostituierten einzudringen und von ihnen zu erzählen. Und wie das Schicksal so spielt: Gleich am Tag meiner Ankunft in der Stadt, komme ich als erstes in ein derartiges Etablissement. Hier, in dieser Unterkunft, für die ich wegen des geringen Preises mit meiner Kreditkarte gleich eine Woche im Voraus bezahlt hatte, war ich möglicherweise mitten unter die Mafia geraten.
Jetzt, während ich mir am Computer meine gesammelten Unterlagen und Fotos ansehe, zwischen drei verschiedenen Word-Dateien hin- und herspringe und mir Wörter und Sätze notiere, denke ich wieder an die ersten Tage im Zimmer jenes Hotels zurück. Wie schrecklich unglücklich ich damals war. Wegen der Männer, die mir im Leben übel mitgespielt hatten – ohne je echter Bestandteil meines Lebens gewesen zu sein – meiner Mutter, die mir mit ihrer Kaltherzigkeit eine schwere Kindheit bereitet hatte, und die ich für mein gestörtes Urvertrauen verantwortlich machte, und weil mein Vater viel zu früh gestorben war. Aber am meisten, weil ich so einsam war. Dann musste ich plötzlich wieder an diesen Orhan denken, und die Erinnerung an seine wiederholten Zurückweisungen sprengte mir fast das Gehirn, dabei war ich mit ihm nur ein paar Monate zusammen gewesen, aber dadurch, dass er immer mal wieder auf- und dann wieder abtauchte, machte er mir noch jahrelang quälend bewusst, wie sehr er mir fehlte. Aber solche Gefühle lagen mir fern, als ich nach Berlin kam. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich hier einsam fühlen könnte. Ich kannte die Akademiker, die aus politischen Gründen ihre Posten verloren und sich hier niedergelassen hatten, allerdings nur dem Namen nach, nicht persönlich. Und den Kontakt zu meinem eigentlich einzigen Freund in der Stadt, Kenan, kann man auch als vernachlässigbar bezeichnen. Er hatte mit mir an der gleichen Fakultät studiert, sich dann aber irgendwann entschlossen zu seiner Mutter nach Berlin zu ziehen, um sein Studium dort fortzusetzen. Kenans Biographie folgt nicht dem allgemein üblichen Verlauf, das Heute und das Morgen passieren bei ihm irgendwie gleichzeitig. Er ist Student, Vater und Berufstätiger in einem. Immer noch studiert er Turkologie, arbeitet in Teilzeit und kümmert sich um seine zweijährige Tochter. Einmal verabredeten wir uns. Kenan, der bei unserem Treffen seine schlafende Tochter im Tragetuch dabeihatte, wirkte müde, aber auch glücklich mit seiner Tochter. Oder ich empfand diesen Zustand, in dem er allem ein wenig fern schien, seinem Kind aber ganz nah, nur als Glück und hielt seine geistige Abwesenheit nur fälschlicherweise für Müdigkeit. Ich würde sagen, es war so eine Art von Abwesenheit, die andere irritiert, sie auf Abstand gehen lässt, aber… Nein. Zwischendurch zeigte Kenan durchaus Interesse. Als ich ihm nämlich erzählte, in den Archiven der hiesigen Zeitungen noch nicht auf den Namen Suat Derviş gestoßen zu sein, war er auf einen Schlag wieder hellwach und begann, mir Fragen zum Thema zu stellen. Kenan, der für den Schriftsteller Peyami Safa schwärmte, mit dessen Tendenz zu Hitler jedoch ein Problem hatte, der Ahmet Hamdi Tanpınars Romane, besonders Das Uhrenstellinstitut in den Himmel hob, hatte von einer weiblichen Schriftstellerin namens Suat Derviş, die deren Zeitgenossin war, und die damals viel mehr von sich reden machte als ihre männlichen Kollegen, noch keine einzige Zeile gelesen, und ganz offensichtlich deshalb leuchtete es ihm ein, dass meine Nachforschungen nach ihr ergebnislos geblieben waren.
Wer findet nicht gern einen guten Grund für seine Wissenslücke? In der Tat hatte Kenan eine grundlegende Lethargie an sich. Es wirkte, als habe er seinen vor Jahren noch teilnahmsvollen, ehemals neugierigen Blick auf alles, was ihn umgab, abgewendet und nur noch auf seine Tochter gerichtet.
Oder setzte es mir so zu, dass ich den früher so aufrichtigen freundschaftlichen Blick meines ehemaligen Kommilitonen nicht mehr entdecken konnte? Mag sein. Vielleicht aber liegt mein Problem auch darin, dass ich kaum Kontakt zu anderen Menschen habe? Aber dieses Gefühl von Einsamkeit hatte ich nur vorübergehend. Ich war ja beschäftigt, verfolgte ein Ziel. Ich hatte eine ganze Bibliothek auf dem Rechner, die man wirklich nicht als klein bezeichnen kann, und mit meinem Deutsch, mit dem ich in der Schule angefangen, und in Kursen an der Uni ausgebaut hatte und jetzt durch beständiges Lesen immer besser verstand, konnte ich zufrieden sein.
Als es nach dem heißen Sommer und Herbst kalt wurde, zog ich in zwei möblierte Zimmer. Meine Güte, war es schwer gewesen, in der Motzstraße etwas Freies zu finden. Nur für einen Monat. Ich wollte mich in diesem einen Monat auf die Spuren der Schriftstellerinnen begeben, die hier einst gelebt hatten. Aus der Staatsbibliothek, wo ich täglich vorbeischaute, entlieh ich mir Nabokovs Maschenka und Irmgard Keuns Das kunstseidene Mädchen in türkischer Übersetzung, und in Istanbul hatte ich in einem Antiquariat die Gedichte von Else Lasker-Schüler gefunden und mit hierhergebracht. Dieses Buch in der Hand, passierte ich jeden Tag das Hotel, in dem diese jüdische Autorin aus begütertem Elternhaus wohnte.
Wie sonderbar, ich bin noch keinen Monat aus dieser Straße fortgezogen; aber als ich vor ein paar Tagen wieder einmal dort vorbeikam, ertappte ich mich dabei, wie ich auf Spurensuche nach mir selbst war. Vielleicht schreibe ich jeder Straße, in der ich wohne, ein wenig von meiner eigenen Geschichte ein. Wer weiß? Aber spielt das irgendeine Rolle? Ich gehe fest davon aus, wieder in mein Leben in Istanbul zurückzukehren – was ich fühle, tut da nichts zur Sache. So war es auch, als ich damals in diesem Hotelzimmer tagelang heulte. Ich sagte mir: „Du bist aus einem ganz bestimmten Grund hier, jetzt ziehst du das durch, dann gehst du wieder zurück!“
Und dabei bleibe ich. Es hat sich ja nichts geändert. Nur dass mir die Fachschaftssekretärin freundlicherweise in einer Mail gewisse Andeutungen gemacht hat, und als ich sie dann anrief, verriet sie mir unter der Hand noch mehr: Der Dekan hatte von ihr wissen wollen, wie lange mein Stipendium noch laufe und wann mein unbezahlter Urlaub vorbei sei. Eigentlich war mir schon klar, dass da etwas im Busch war. Irgendetwas, das sie mir nicht so klar und konkret sagen konnte. Das Schlimme an der Sache: Jetzt bin ich schon zwei Monate hier, verbringe einen Großteil meines Tages in der Staatsbibliothek, der bestausgestatteten Bibliothek der Welt, in der sich fast jedes türkische Buch auftreiben lässt, aber außer dem, was jeder andere auch im Internet finden kann, habe ich nichts in der Hand. Das digitale Archiv ist ein Ozean, und dann gibt es da noch einen nicht digitalisierten Teil. Vielleicht erschließt sich mir Suat Derviş‘ Leben hier in Berlin am besten, wenn ich diese noch nicht digitalisierten Bestände durchstöbere. Doch dafür muss ich mir erst über die Chronologie im Klaren werden. Wann ist sie genau hier eingetroffen, wo und wann erschien ihr erster Text? Und vor allem, ist der Roman, den sie in ihren Memoiren erwähnt, tatsächlich hier als Fortsetzungsroman in der Zeitung erschienen? Oder habe ich es mit dem Ego einer Autorin zu tun, die sich beim Schreiben größer macht, als sie ist, und mit der Stimme einer Frau, die versucht, sich in der Welt der Männer zu beweisen?
Drei Monate habe ich mindestens noch, wenn ich mir ein Attest beschaffe, vier. Aber reicht die Zeit, um noch etwas Substantielles zu finden. Bin ich fähig, eine Frau des vorigen Jahrhunderts zu erfassen, immer berücksichtigend, dass sie eine Osmanin war und im Haus eines Paschas aufwuchs? Bin ich überhaupt in der Lage, mir vorzustellen, wie eine Frau aus einer komplett anderen Epoche und Gesellschaftsschicht durch die Straßen geht, nachzuvollziehen, wonach sie sucht, mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat? Aber ich weiß auch sehr gut, dass es mir nur möglich sein wird, mit ihrer Geschichte in dieser Stadt fortzufahren, indem ich meine Phantasie spielen lasse, mir ausmale, wie sie hier eintrifft, welchen Menschen sie begegnet, und wie sie gerade jetzt in einem Pensionszimmer in der Motzstraße erwacht…
………………………………….
Erwachen Teil 3
In der Motz war es laut. Die Straßenschlucht hallte wider vom Hämmern auf den Baustellen, dem Quietschen der Pferdebahn und den Tritten der Hufe. Das Wiehern und Geklapper verschmolz mit dem Kreischen der Möwen. Suat spähte durch die nur halbgeöffneten Lider und suchte nach dem Licht, das ihr vertraut war. Nach dem Meer, das mit zunehmender Helligkeit immer klarer wird. Ihre Gedanken wanderten zum Meeresleuchten, das erst auftreten kann, sobald das Licht fort ist, dann dachte sie an die Dunstschwaden, und schließlich an Nebelschleier. Immer schon hatte sie sich gefragt, wie es möglich war, dass dieses ohnehin so geheimnisvolle Meer unter Nebelschwaden noch geheimnisvoller wirkte? Dieser Nebel sammelt sich manchmal über den Inseln im Marmarameer, verharrt dort stundenlang und verschluckt mit seinem Weiß alles Sichtbare. Irgendwann kommt dann Wind auf und vertreibt dieses blindmachende Weiß. Gelegentlich flog eine Möwe vorbei, ganz nah, riesengroß, einer ihrer Flügel berührte die Fensterscheibe ihrer Zimmer, der andere Flügel reichte hinüber bis zu den Inseln weiter hinten. Oft beobachtete sie den ganzen Tag lang die aus der Ferne winzig klein aussehenden Fischerboote, die Gondeln, mit denen sie als Kinder häufig fuhren, die von weither kommenden und vorüber ziehenden Frachter. Nachts war jedes dieser Schiffe ein blinkendes Licht im Nichts dieser schwarzen Wasser; und der Wind brauste unheilvoll. Wenn dann nach dem Abendessen bei frisch gerösteten Kichererbsen und gebackenen Kartoffeln aus dem Kachelofen noch Geschichten von lodernd flammenden Dämonen, wiederauferstandenen Seelen und Dschinn erzählt wurden, die es auf kleine Mädchen und junge Damen abgesehen haben, war das Brausen des Windes von Schreckensrufen begleitet. Die noch ganz, ganz kleine Suat schlich sich dann angsterfüllt auf Zehenspitzen zum Bett ihrer gerade mal vier Jahre älteren Schwester hinüber, kroch schnell unter ihre Decke und schmiegte sich an ihren warmen Körper. Sobald ihre Hand in der Hand der Schwester ruhte, verhallten all die Geräusche wieder.
Das minderte auch das Sehnen nach der Mutter ein wenig; nach der in diesem Haus geborenen und aufgewachsenen Mutter, die sie vergötterten, nach der sie sich verzehrten, die aber immer unnahbar war; diese schöne Frau, die dem Begehren der Kinder nach liebevoller Zuwendung mit Kopfschmerzen begegnete. Die überschwängliche Liebe des Vaters sollte vielleicht die von der Mutter gewahrte Distanz ein wenig ausgleichen. Aber für diese Liebe gab es noch einen ganz anderen Grund: Jener Doktor İsmail Derviş war Spezialist für Geburtshilfe, und hatte als solcher seinen Kindern auf der ersten schwierigen Reise in diese Welt zur Seite gestanden. Was für ein Glück. Welches osmanische Kind wurde schon in die Hände des Vaters hineingeboren? Und wieviele muslimische Kinder taten überhaupt ihren ersten Schrei in diesem Universum im Arm eines Arztes damals?
Die offiziell als Saadet Hatice eingetragene Suat schlug nun im Halbdunkel eines Zimmers in der Motzstraße ihre Augen auf und wie sie so über ihr Leben nachdachte, meinte sie für einen Moment, sich noch an diesen ersten Schrei erinnern zu können. War das möglich, ist der Mensch in der Lage, sich an seine Geburt zu erinnern? Daran, wie er aus einem finsteren Durchlass in diese Welt hineingeworfen wird, an dieses beängstigende Gequetscht werden, an sein erstes Entsetzen, seinen ersten Schmerz? Doch musste nicht die Mutter den größten Schmerz erleiden, und war das vielleicht der Grund für die Unnahbarkeit der Mutter?
Aber da waren noch Kindermädchen, die Amme, Dienerinnen und die große Schwester. Ganz unten im Haus roch es immer so gut aus dem Vorratsraum gleich neben dem Ofen. Nach Orangen und Äpfeln, die dort für den Winter eingelagert waren… In den Duft der Orangen mischte sich Kaffeegeruch. Diese Gerüche waren mit der Erinnerung an einen ganz bestimmten Moment verknüpft, den sie nie vergessen würde. Wie alt war sie da gewesen? Vier Jahre, oder fünf? Es ist der Garten des Harems. Außer ihr ist niemand da. Sie hält eine Kunststoff-Puppe im Arm, die sie jetzt eindeutig für tot hält. Auf einem immer schmaler werdenden Weg geht sie an den Kirsch- und Pflaumenbäumen vorbei den Hang hinab. Dabei tritt sie auf jahrhundertealte bemooste, überwucherte Steinstufen, um sie her alte Bäume mit dicken Stämmen, die vielleicht schon seit byzantinischer Zeit hier stehen. Der Weg wird immer noch schmaler. Sie hat sich verlaufen. Ein gespenstisches Rauschen. Angst. Und von irgendwoher die zarte Kinderstimme der Schwester: “Suat, Süße, wo bist Du?”
Da heulte ein Motor auf, und zwischen den Vorhangspalt hindurch spähte Suat hinaus. Was für ein grauer Himmel. Das Bett ihrer Schwester war leer, darüber lag die mit Spitze verzierte Bettdecke, die sie aus Istanbul mitgebracht hatten, so als wäre das Bett die ganze Nacht nicht berührt worden. Die Tür des elfenbeinfarbenen Kleiderschranks stand etwas offen; der Saum ihres beigefarbenen Kleides hing heraus. Ein bunt gesprenkelter Paravent, ein roter Sessel, eine Chaiselongue. Das Ticken der Wanduhr war zu hören. Die Zeiger standen auf Zehn.
Schließlich schlug sie die Bettdecke zurück und stand auf. Sie nahm ihren Morgenmantel vom Fußteil des Bettes und ging, während sie ihn überzog, zum Fenster hinüber. Dann schob sie den Vorhang ganz zur Seite und öffnete das Fenster. Der kühle Wind, der ihr ins Gesicht fuhr, ließ sie zurückschrecken. Von der Baustelle vorne an der Straße hörte man nun ein Sägen. Die Luft roch nach Regen, Kohl und frischgebackenem Brot, gemischt mit Briketts. Gegenüber in der Bäckerei mit der blauen Markise, auf der der Schriftzug „Motz-Brot“ prangte, huschten schwarze Schatten geschäftig hin und her. Kurz darauf ging die Ladentür bimmelnd auf und eine Frau mit Schürze trat heraus. Sie hatte einen Eimer und einen großen Besen dabei und begann vor dem Eingang zu kehren.
Während Suat all dies beobachtete, fiel ihr plötzlich etwas auf: Bis gestern noch hatte sich, beim Blick aus dem Fenster alles bewegt, war alles irgendwie an ihr vorübergezogen als säße sie nach der tagelangen Reise immer noch im Zug. Jetzt aber war dieses Rasen zu Ende, und die Straße, die Dinge, alles, was sie nun sah, ging wieder seinen normalen Gang. Und endlich war auch diese Erschöpfung vorbei, die sie tagelang niedergedrückt hatte.
Sie musste sich erleichtern, sich waschen. Danach der Morgenkaffee. Wie hieß doch gleich die Pensionswirtin? Frau Sax. Und ihre Tochter hieß Rose. Rose, die Sekretärin. Wo war eigentlich Hamiyet?
Sie schloss das Fenster, wandte sich um und sagte laut: „Ach ja, sie hatte ja heute gleich morgens einen Termin im Konservatorium!“ Die Schwester hatte ein Talent für das Klavier, aber sie selbst war dafür nicht ausdauernd genug… Nein, deswegen wollte sie sich nicht grämen. Die Musik fordert ernsthaftes Bemühen, Talent, Disziplin und Hingabe. Das war ja der Grund gewesen, warum sie sich im Konservatorium abgemeldet und im Fach Deutsche Literaturgeschichte eingeschrieben hatte. Voller Inbrunst sagte sie: „Studentin Hatice Saadet Suat Derviş“. Noch dazu Studentin an der ehrwürdigen Universität. Da fiel ihr der junge Mann wieder ein, dem sie vor drei Tagen am Bahnhof begegnet war, das war ein ernsthafter Student. Sogar einer, den der Staat entsandt hatte. Wie war sein Name? Sabahattin. Sabahattin Ali. Reşat Fuat war doch auch seinerzeit von offizieller Seite zum Studieren geschickt worden, nicht wahr? Aber er hatte sein Studium schon vor längerer Zeit abgeschlossen, sinnierte sie weiter. Irgendjemand hatte ihr erzählt, dass er nach seinem Chemiestudium hier in Berlin, nach Russland auf die Moskauer Universität gegangen war. Der rote Reşat! Sie erinnerte sich, wie sie ihm das erste Mal vor drei Jahren in einem Zug nach Wien begegnete, als er mit einer größeren Gruppe unterwegs war. Sie hatten sich einander im Speisewagen vorgestellt und sogar ein wenig geplaudert. Aber die Gruppe, die ihn begleitete, war so groß und so laut, dass sie sich kaum hatten verständigen können. Diese Gruppe kam von einer internationalen Tagung zurück. Sie, ihre Schwester und ein paar Kommilitonen vom Konservatorium waren zur Wiener Staatsoper gereist, um sich eine Operette anzusehen. Stimmt, fiel es ihr wieder ein, damals war ich auch noch am Konservatorium. Wie mich der Unterricht dort gelangweilt hat. Aber dieses Wien, die Zugfahrt, und dann die Begegnung mit Nâzım Hikmet, der gerade aus Istanbul kam, oder war es doch Russland gewesen? Ob sich Reşat Fuat und Nâzım wirklich kannten damals? Wer hatte ihr noch gleich später erzählt, dass Reşat Mustafa Kemals Cousin war. Konnte das Nâzım gewesen sein? Aber nein, sie erinnerte sich nicht daran. Damals war sie mit ihren Gedanken wohl ganz woanders gewesen. Mit seiner Ernsthaftigkeit, seiner stillen Art und dem dennoch so herzlichen Blick hatte dieser Mann zwar ihre Aufmerksamkeit erregt, aber später hatte sie ihn wieder aus dem Gedächtnis verloren.
Als ihr Blick am Kleiderschrank mit der halb geöffneten Tür hängenblieb, vergaß sie all das wieder. Sie ging hin, klappte die Tür ganz auf und zog von unten ihre Tasche heraus. Dann ließ sie sich auf der Chaiselongue nieder.
Behutsam legte sie ein paar Hefte, zwei französische Romane und ein Holzkistchen mit Tintenfass auf den flauschigen Teppich. Eine Weile sah sie sich diese Dinge liebevoll an, dann zog sie die Zeitung aus dem Seitenfach der Tasche und streckte sich auf der Chaiselongue aus. Sie blätterte die Zeitung auf ihrem Schoß durch und hatte plötzlich die Mittelseite mit ihrem Foto vor sich. Der Text unter diesem Foto begann mit den Worten: „Die auch in Deutschland bekannte Autorin dieser wunderschönen Geschichte, welche die B.Z. am Mittag in den vergangenen Tagen abdruckte…“. Die zweite Meldung bezog sich auf Hüseyin Rahmi. Weil einem Leser der Ausgang seiner in der Zeitung erschienenen Fortsetzungsgeschichte nicht gefallen hatte, änderte der Autor, als der Roman als Buch erscheinen sollte, kurzerhand das Ende, und statt den Helden zu töten, ließ er ihn am Leben.
Sie musste kurz auflachen. Friedmann bringt also tatsächlich auch Literaturklatsch- und tratsch. Damit macht er den Leser ganz beiläufig neugierig. Dann las sie noch einmal den ersten Satz unter ihrem Bild: „Die auch in Deutschland bekannte…“. Sie fing an zu träumen: Wirklich, war das möglich? Hier, in Berlin? Zu schreiben, Geld zu verdienen, hier zu leben…? Konnte das funktionieren? Einen Tisch in dieses Zimmer zu stellen, mit dem Schreiben anzufangen, Verlage abzuklappern? Jetzt, nachdem Hamiyet entschlossen war, ihr Studium am Konservatorium fortzusetzen… Warum denn nicht? Außerdem könnte ja auch die Familie herkommen. Ruhi könnte hier zur Schule gehen. Schließlich hatten sie auch früher schon jahrelang hier gelebt, waren nicht nur auf Reisen in Berlin gewesen. Als Touristen waren sie erst ein einziges Mal hergekommen, zusammen mit ihrem Vater. Der Vater mit seiner ungebrochenen Begeisterung für Deutschland hatte seinen Töchtern die Hauptstadt der jungen Weimarer Republik gezeigt. Ohne ihn hätten sie sich in dieser riesigen Stadt bestimmt gefürchtet. Das war im Sommer gewesen, die Stadt war wunderschön, aber auch schrecklich laut. Was hatte sie damals nur alles entdeckt, von welchen Autoren Bücher gelesen? Von Thomas Mann, von der Königin des Horrors Mary Shelley in deutscher Übersetzung, Texte eines jungen Philosophen namens Walter Benjamin über sein Leben in dieser Stadt. Das war eine Zeit, die ihr die Literatur und das Schreiben nahegebracht hatte. Damals war sie in Istanbul noch ein unbedarfter Neuling als Schriftstellerin gewesen, deren erstes Werk gerade erst als Fortsetzungsroman gedruckt worden war. In ihrem Kopf spielten sich die schrecklichsten, verrücktesten Spukgeschichten ab, und alles, was sie da im Geiste sah, tauchte in dem, was sie schrieb, auf. Und sie wusste, dass das, was da als Spiegel ihrer selbst auftauchte, die atemberaubende Magie eines Autors und seines Glanzes ausmachte.
Nun stand ihr das fein gezeichnete, schöne Gesicht ihres Vaters mit der Brille vor Augen und sie seufzte liebevoll, aber auch bedauernd. Eigentlich hatte sie damals gar nicht richtig mitbekommen, was er alles durchmachte. So viel, dass ihr Vater wohl auch ein wenig aus dem Grund hierhergekommen war, seine Enttäuschung zu überwinden. Wer weiß, vielleicht wollte er seinen Töchtern aus diesem Grund eine andere Welt zeigen, ihnen zeigen, dass man auch anders leben konnte. Die Republik war ausgerufen worden, aber für ihren Vater, der doch auch unter den Jungtürken gewesen war, hatte man keine Verwendung. Der Sohn eines Paschas Dr. Ismail Derviş war schlichtweg übergangen worden. Hatte man ihn vergessen, oder war man der Auffassung, ein Gynäkologe sei als Staatsmann ungeeignet? Eigentlich hatte ihn seine Tochter Suat stets für einen hellsichtigen Menschen gehalten. Bereits in den allerersten Tagen der Republik, hatte er seine Tochter beiseite genommen und ihr geraten: „Suat, du solltest das lateinische Alphabet gut pflegen, du wirst es bald benutzen müssen, wenn du schreibst.“ Und ihr Vater war es auch gewesen, der sie nach ihren ersten kurzen Erzählungen anspornte, einen Roman zu schreiben, der las, was sie verfasste und ihr sagte, was er darüber dachte.
Plötzlich hörte sie etwas, sie ließ die Zeitung auf die Chaiselongue sinken. Jemand klopfte an die Tür. Beim Aufstehen knöpfte sie den Morgenmantel zu und schlüpfte in die Pantoffeln. Erneut klopfte es heftig an die Tür; Suat hörte eine Frau murren.
Vor der Tür standen, mit gravitätischen Mienen, ganz so als wären sie auf Kontrollgang, die Pensionswirtin Frau Sax und das blasse Zimmermädchen. Am Boden stand ein Eimer Wasser mit Putzlappen.
Frau Sax deutete auf den Eimer und das Zimmermädchen und sagte: „Hier gleich putzen!“ Dann wollte sie wissen, ob Suat einen Kaffee wünschte. Sie sprach im Berliner Dialekt. Irgendwie hörte sich das so an, als hätte sich die Frau darüber beschwert, dass Suat zu lange geschlafen habe. Der Dialekt war äußerst ausgeprägt, und Suat musste sich sehr anstrengen, um etwas zu verstehen, weil die Worte im Mund dieser Frau zu Variationen von Brummlauten wurden, so dass nur zu raten war, was sie sagte. Die Hauswirtin und ihre Helferin zogen sich zurück, als von der Treppe her das Klappern von Absätzen und auffahrende und wieder leiser werdende Stimmen zu hören waren, die nach einem Streitgespräch klangen. Das war die Russin mit ihrer Tochter, die sich im obersten Stockwerk eingemietet hatte. In den vergangenen drei Tagen war Suat ihnen mehrfach, mal in der Küche, mal auf dem Gang begegnet, mehr als ein unauffälliges Grüßen war dabei nicht zustande gekommen. Die Mutter sagte „Bonjour“. Die schmale Tochter mit dem feinen Gesichtchen und den wimpernlosen Augen senkte nur scheu den Blick. In dem Moment war von unten Hamiyets Stimme zu vernehmen.
Sie war recht ausgelassen heute. Wie edel, wie unnahbar sie wirkte mit ihrem dunklen Haar, der schlanken, hochgewachsenen Gestalt und dem gelben Strohhut.
Während Suat vor dem Schrank einen dunklen Rock und eine weiße Bluse anzog, setzte sich Hamiyet auf die Chaiselongue.
Hamiyet begann zu erzählen: „Wie gut, dass ich in Istanbul den ganzen Sommer am Klavier verbracht habe“. Die Lehrerin hatte sie nämlich für ein Lied von Brahms gelobt. Hamiyet berichtete, sie wolle von nun an Gesangsunterricht nehmen, bei einer neuen Lehrerin, die früher Opernsängerin gewesen sei, allerdings noch recht jung, deren Stimme aber wegen einer Erkrankung gelitten habe, und sie deswegen angefangen habe, am Konservatorium zu unterrichten. Dann deutete sie nacheinander auf die umgeschlagene Zeitung auf der Chaiselongue und das Kästchen mit dem Tintenfass am Boden. „Süße, du hast doch nicht etwa vor, den lieben langen Tag hier herumzusitzen! Du solltest zur Uni gehen. Das hindert dich doch nicht am Romanschreiben. Ach, mir geht es so gut. Heute dachte ich mir, wenn es doch nur möglich wäre, für immer hier zu leben!“
„Ja, aber dafür muss man Geld verdienen. Wir können ja nicht immer Geld von Zuhause fordern. Andererseits…“
Suat beendete den Satz nicht. Vorsichtig sah sie zu Hamiyet hinüber. Ach nein, sie wollte jetzt nicht von einem geeigneten Heiratskandidaten anfangen, und ihre Schwester an ihr Alleinsein erinnern, das machte sie immer so traurig. Aber waren sie nicht eben deswegen hergekommen? Hatten sie nicht gehofft, dass Hamiyet hier einen passenden Ehemann finden würde, auch wenn es nicht explizit ausgesprochen worden war und immer nur vom Konservatorium die Rede war.
Suat warf ihrer Schwester einen prüfenden Blick zu, weil sie wissen wollte, ob darin ein Anflug von Traurigkeit zu finden sei, doch Hamiyet wirkte eher versonnen. Jedoch auch diese Versonnenheit streifte sie schnell wieder ab und fragte aufgeregt: „Weißt du, was gerade geschehen ist? Ich habe am Markt eine alte Bekannte getroffen. Vor zehn Jahren habe ich doch bei einer Telefongesellschaft gearbeitet. Da war so eine ganz hübsche, sehr nette Kollegin. Leyla heißt sie… Von irgendjemand hatte ich gehört, dass sie geheiratet hat und wieder geschieden ist, dass sie daraufhin nach Paris gegangen ist und an der Sorbonne ein Studium anfing. Ja, und gerade dieser Leyla bin ich eben zufällig begegnet. Stell dir das mal vor, mitten in Berlin stehen wir uns plötzlich gegenüber. Ich habe sie in der Menge erst gar nicht gesehen. Erst als sie sich mit einer anderen Frau auf Türkisch unterhalten hat, habe ich sie an der Stimme erkannt.“
Hamiyet kramte in ihrer Handtasche. Endlich fand sie, wonach sie gesucht hatte und zückte einen eleganten, goldverzierten Briefumschlag. „Weißt du, was das ist? Eine Einladung! Eine Einladung zur Eröffnung eines Modehauses, das Leyla und eine andere Istanbulerin miteinander in Berlin, noch dazu in einer ziemlich feinen Straße gründen. Ich war ganz baff. Aber ich habe mich auch sehr gefreut. Ach, die kleine süße Leyla. Denk nur, du gehst von Istanbul nach Paris, entdeckst dort, zusammen mit einer anderen Frau aus Istanbul die Mode für dich, dann kommst du nach Berlin und triffst zufällig eine alte Freundin. Wir gehen doch zur Eröffnung, nicht wahr, Suat?“
In diesem Moment klopfte es an der Tür und ohne eine Antwort abzuwarten, sprang Hamiyet auf: „Das ist das Zimmermädchen!“ Suat betrachtete den goldverzierten Umschlag mit der Aufschrift „Madame Saadi“, den sie in die Hand gedrückt bekommen hatte. Sie legte den Umschlag auf die Kommode und sagte: „Na gut, und ich werde jetzt auch eine fleißige Studentin und gehe zur Uni, versprochen!“
Aus dem Türkischen von Angelika Gillitz-Acar und Angelika Hoch-Hettmann