Arı Fısıltıları – Das Flüstern der Bienen / Auszug
Arı Fısıltıları – Das Flüstern der Bienen
Roman
Menekşe Toprak
Erster Tag
Von den Bergen weht der Wind
Mit sich trägt er auch den Rauch!
Der Wind ist arglos wie ein Kind
Ahnt er deine Abscheulichkeit?
Behçet Necatigil, „Duman-Rauch“
I
Leichtigkeit
Es muss ein Davor geben, ganz bestimmt. Es darf nicht ohne Grund, nicht ohne Vorgeschichte sein, dass sie sich an die watteweichen, an der Unterseite schnurgeraden Haufenwolken klammert, und an den Vogelschwarm, der unter diesen Wolken hindurch der Sonne entgegenzieht. Und doch ist es so. Sie blickt hinunter auf die Stadt, leicht, luftig, von jeglichem Gewicht befreit, falls sie je welches besessen haben sollte. Eine große Straßenkreuzung, geschäftige Menschen, Straßenverkehr, Ampeln, die von Rot auf Gelb, von Gelb auf Grün springen. Sie macht Rettungswagen aus, die von weitem nahen. Sie haben es eilig… Jetzt biegen sie von der Hauptstraße in die Seitenstraße ein. Ans Geländer eines Balkons gelehnt, summt ein kleines Mädchen traumverloren und wehmutsvoll ein Lied, anscheinend glücklich, sich in dieser Wehmut zu verlieren. Auf einem anderen Balkon hängt eine Frau gerade die Wäsche auf, eine Alte unterhält sich mit einer schläfrigen Katze auf dem Fensterbrett, ein Hund bellt mit hochgerecktem Kopf den Himmel an, auf einem Weidenast vollendet ein Spatzenpaar mit den Schnäbeln sein Nest. Gegenüber spazieren drei Mädchen untergehakt an einem Fußballplatz vorüber, werden langsamer und sehen sich die jungen Männer an, die auf dem Platz trainieren. Unter den Blicken der Mädchen bewegen sich die jungen Männer noch flinker, ihre verschwitzten Hälse recken sich, ihre Gesichter beginnen zu strahlen. Sie scheinen leichtfüßiger zu werden, ihre Tritte entschlossener, und ihre Muskeln regelrecht vor Energie zu strotzen. Ach, wie schön ist doch die Erinnerung an das Begehren, an diese Wehmut. Doch ihr Inneres ist gefangen in Einsamkeit und Unnahbarkeit. Was ist das eigentlich, das Innere, wo hat der Mensch sein Inneres? Es ist, als hätte sich dieses Innere gerade entleert, als habe sie es noch festhalten wollen, damit es nicht verströmt, sich nicht auflöst, damit es bleibt und nicht vergeht. Aber was hat sie hier, in diesen Lüften verloren, woher kommt diese Leichtigkeit? Ist das wirklich der Himmel, oder die Erde? Ist es nur ein Gedanke, ein Traum, den der Bürgersteig einsaugt und ausströmt. Diese Stimme. Dieser Schrei. So inbrünstig, aus dem tiefsten Inneren. Der Schrei einer Frau. Der Schoß der Mutter, den sie krabbelnd erreicht. Im Dunkeln endlich der vertraute Geruch. Schließlich die wiedergefundene milchgefüllte Brust.
Sie sieht das Gesicht der Frau, blutrote Tropfen, die von ihren blonden Locken über die Nase rinnen, von der Nase aufs Kinn tropfen. Sie erinnert sich, wie das Etikett ihrer Bluse, das aus dem Kragen gerutscht war, an ihren Fingern kitzelte. Erinnert sich an ihre Hand, ihre Arme, ihre Haut, diesen plötzlichen unbeschreiblichen Schmerz; erinnert sich an dieses Taumeln, das sich anfühlt, als würde sie nach unten, ganz tief nach unten gezogen, sie erinnert sich an den Durst und endlich an die Angst.
Würde doch jemand den Arm, der zu dem Kopf im Schoß der Frau gehört, wieder an seinen Platz legen, die fehlenden Finger wieder anbringen, das Herausgeflossene wieder einfüllen, das Fleisch wieder zu einem ganzen Körper zusammenfügen, ihn waschen und ihm seine frühere Schönheit wiederverleihen, wie zu dem Moment, in dem er am Schönsten war.
Ein junger Mann läuft durch die Menge. Mit einer Plastikflasche in der einen und einem Sesamkringel in der anderen Hand bahnt er sich einen Weg durch die Menschenmenge. Sein Rucksack scheint es noch eiliger zu haben als er und hüpft mitsamt der bunten Troddel am Reißverschluss wild hin und her.
Sie ruft: „Ich habe keinen Durst mehr, Deniz! Bleib stehen, lauf nicht weiter, ich habe keinen Durst mehr!“
Aber Deniz bleibt nicht stehen. Er rennt zu dieser leeren Körperhülle, deren Kopf im Schoß der Frau vergraben ist. Wie Deniz, bahnen sich zwei Männer in weißen Kitteln mit einer Trage den Weg durch das Gewühl, und versuchen eilig zum gleichen Körper zu gelangen. Hinter ihnen folgt hoffend und bangend auch Suna.
Plötzlich steigt eine Gaswolke auf, gelbliches Wasser spritzt durch die Gegend, die Menge flieht drängelnd und drückend nach allen Seiten, die Männer in den weißen Kitteln verlieren das Gleichgewicht und lassen die Trage fallen. Deniz, die Frau, der Körper, die roten Flecken, der nasse Bürgersteig, der das rote Blut in sich aufnimmt, all das ist nicht mehr zu sehen. Doch Suna sucht weiter nach dem Körper, der irgendwo unter der Gaswolke verschwunden ist. Sie denkt nur das eine: Ihn finden und aufrichten, mit Deniz zusammen losgehen, raus aus dieser Hölle, dann entweder den Bus nach Deniz‘ Heimatstadt nehmen, zur Mutter, die dort bei den heißen Quellen auf sie wartet, oder aber in einen anderen Bus steigen und nach Hause zurückkehren.
II
Irgendwo in der Ferne
Die Erde regte sich wieder und erwachte zu neuem Leben, da trat die alte Nesibe vor die nach Osten gelegene Tür ihres Hauses und hielt ihr Gesicht in die Sonne. Es erinnerte an die ausgedörrte, rissige Erde im Herbst und an das mit dieser Erde verbackene Gestein. Wenn Nesibe ihre Lippen bewegte, wippte ein kleines weißes Bärtchen unter ihrem Kinn mit. Während die Frau die aufgehende Sonne begrüßte, ohne zu wissen, dass sie damit das Ritual einer uralten Religion zelebrierte, vielleicht auch ohne für das, was sie wusste, einen Namen zu haben, sammelte ein alter Mann Pilze, die der Regen vom Vorabend am felsigen Hang hatte aufschießen lassen. Als er sich nach vorne beugte, tropften aus seinen Augen zwei Tränen auf einen Pilz. Der Pilz erbebte vom salzigen Nass und verdunkelte sich mit dem Kummer des Mannes. Für eine Weile setzte sich der alte Mann an den Hang und betrauerte die Sinnlosigkeit des Lebens, ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, wer weiß wie vielen Käfern und Ameisen er genau in diesem Moment selbst das Licht ihres ohnehin kurzen Lebens auslöschte; er klagte sein Leid den Bergen, Steinen, Bäumen. Dann stieg er weiter ab, beobachtete, als er an einer üppig blühenden Sommerweide vorbeikam, wie die Schmetterlinge und Wildbienen, deren Summen im Laufe des Frühlings immer intensiver wurde, von einer Blüte zur nächsten flogen, und setzte seinen Weg fort; noch etwas unterhalb der Weide ließ ihn ein Summen aufhorchen, das aus einem Bienennest in einer Felsspalte kam, die zum Friedhof hin lag. Hätte er einen Blick in dieses Nest hineinwerfen können, dann hätte er das, was dort zu sehen gewesen wäre, auf seine eigene Welt übertragen können, und erfahren, wie fürsorglich die Arbeiterinnen zwei neue Königinnenanwärterinnen mit Bienenmilch versorgten, und wie sich gleichzeitig die alte Königin nach der Geburt der beiden Königinnenanwärterinnen, auf ihr nahes Ende vorbereitete. Aber auch ohne es zu sehen, hätte er etwas von dem natürlichen Widerstreit von Leben und Tod in der Natur erahnen können. Schließlich waren es nicht die Pilze, die ihn an diese Felshänge geführt hatten, sondern der Tod. Auf diese Weise verabschiedete er sich noch vor der Trauergemeinde von der Tochter seines Onkels, die mit ihm im gleichen Haus aufgewachsen und ihm in seiner Erinnerung wie eine Schwester gewesen war, die in der Fremde gelebt hatte und deren Leichnam noch am gleichen Tag gebracht werden sollte. Doch ein wenig beweinte er auch sein eigenes Alter. Die Vergänglichkeit, die Sinnlosigkeit des Lebens, die Ungewissheit, wann für wen die letzte Stunde kommt.
Der Mann auf der Anhöhe stellte sich aufrecht hin und ließ seinen Blick über die Landschaft gleiten, die im klaren Licht nach dem Regen wie geläutert war. Ein Fremder hätte den Ort da unten am Fuß der Bergkette, der geprägt war von fünf bis sechs Jahre alten Häusern mit Ziegeldach oder Terrasse, für ein kürzlich erst errichtetes Feriendorf halten können, wären da nicht vereinzelt auch noch die wie Höhlen anmutenden Lehmhäuser gewesen, wie das von Nesibe. Die Asphaltstraße schlängelte sich sanft zwischen den ziegelroten Dächern, dem weißen Gestein und den grünen Pappeln und Hügeln hindurch, führte einen Hang hinunter und, zwischen den Feldern am Haus von Derviş vorbei, in die Kreisstadt. Ringsum war es still, harmonisch. Als würde alles am Fuße der weiten Berge, selbst die Seelen in den Gräbern auf der Anhöhe innehalten, nicht um auf das unvermeidliche Ende eines alten Menschen zu warten, sondern darauf, dass er eins würde mit dieser Harmonie.
Der Alte, dessen Gesichtsausdruck verriet, dass er in Gedanken immer noch bei der Aussicht war, machte sich auf den Heimweg, und weil er sein Hörgerät nicht eingesetzt hatte, bekam er nicht mit, dass sich von hinten zwei Autos näherten, eines weiß mit Anhänger, das andere bordeauxrot. Sie fuhren so behäbig auf das Heck eines Wagens zu, der an der Zufahrt zu Derviş‘ Haus stand, als würden sie unter ihrer schweren Last fast zusammenbrechen. Als der Alte zuhause in seiner Küche die Pilze auf einer kupfernen Platte auslegte, erkannte er durch das Fenster und die beschlagene Brille vage, wer aus den Autos stieg. Er seufzte schwer und sagte: „Jetzt haben sie sie also gebracht!“ Doch dann fragte er sich: „Was machen sie denn bei Derviş?“ Neugierig kniff er die Augen zusammen und presste das Gesicht fast an die Fensterscheibe. Da sah er drei Personen aussteigen – eine Frau, einen Mann und ein junges Mädchen – er sah, wie die beiden zierlichen weiblichen Gestalten aus dem bordeauxroten Wagen fröstelten an diesem eisigen Morgen und auf das Haus von Derviş zugingen, und wie der Mann aus dem Wagen mit dem Anhänger sich an den vorderen Kotflügel seines Fahrzeuges lehnte, sich eine Zigarette ansteckte, und den Rauch wie erleichtert aufatmend, in Richtung der Bergkette blies. „Nein!“, entschied der Alte, „das sind nicht die unseren!“
Traum
Während die alte, bucklige Nesibe bereits ihre Morgensuppe zubereitet und geschlürft, langsam wie eine Schildkröte ihr Tagwerk verrichtet und ihre schmerzenden Knochen in die feierlich begrüßten frühen Sonnenstrahlen gereckt hatte, lag Derviş noch immer im unruhigen Morgenschlaf. Er war in diese Gegend gekommen, weil er es sich in den Kopf gesetzt hatte, einem unfruchtbaren Acker, der von seinen Vorfahren auf ihn gekommen war, wieder Leben einzuhauchen; doch irgendwie schaffte er es einfach nicht, in aller Frühe bei Tagesanbruch aus dem Bett zu kommen. Dabei wusste er, dass heute der Leichnam einer alten Frau eintreffen würde, die zwar keine Verwandte war, von der jedoch seine Mutter zeitlebens immer wieder erzählt hatte. Außerdem war es in diesen kleinen Nestern üblich, dass ganz unabhängig von Freundschaft oder Verwandtschaft, jeder Leichnam von allen gemeinsam zu Grabe getragen, und jede Seele, die zu Gott dem Gerechten einging, wie das eigene Fleisch und Blut der Erde übergeben wurde.
Derviş saß in einem düsteren, tristen Kundenraum. Die anderen Schalter ringsum lagen im Dunkeln, nur in die Ecke, in der er saß, fiel ein eisiger Lichtstrahl, wie um ihn als Übeltäter anzuprangern. Die Krawatte schnürte ihm fast die Kehle ab. Er lockerte sie immer wieder, aber das verschaffte ihm keine Erleichterung. Sein weißes Hemd war feucht und klebte an ihm, nicht weil es im zu heiß gewesen wäre, sondern weil er regelrecht Panik hatte. Die Kasse stand offen, die Geldzählmaschine ratterte unaufhörlich. Die junge Vorgesetzte rief: „Wo sind Sie nur mit Ihren Gedanken, Sie sind unaufmerksam, nicht bei der Sache, vertrödeln unsere Zeit, Sie sitzen hier am verantwortungsvollsten Posten, aber Ihre Kasse stimmt nicht. Wieder mal nicht!“ Derviş legte die auf seinen Schoß gefallenen Kassenstreifenrollen mit den Zahlenkolonnen und das abgezählte Geld nebeneinander und glich die Buchungen Posten für Posten ab. „Auch wenn sie hier noch ihr ganzes Leben lang arbeiten, werden Sie das bei Ihrem Gehalt nie begleichen können“, legte sie nach. Da ging es Derviş durch den Kopf: Leben nennst Du das? Wie lang soll das denn so weitergehen? Ein Leben lang nichts als diese Arbeit? Sollte tatsächlich der alleinige Sinn seines Lebens darin bestehen, in dem engen Raum hier dieses dreckige Geld zu zählen, das schon durch unzählige Hände gegangen war? Das ist kein Job für einen, der studiert hat. Ach, wenn ich bloß eine Fremdsprache könnte, und sie mich bei der Bank für die Ausbildung zum leitenden Angestellten genommen hätten, na ja, der Zug ist längst abgefahren. Nicht einmal Beziehungen habe ich… Wenn ich schon mein Leben in dieser Bank vertun muss, dann wenigstens in den oberen Etagen mit Panoramascheibe und freiem Blick auf die Welt… Vielleicht würde mich dann Azime jeden Morgen mit einem: ‚Aufstehen! Die Arbeit ruft!‘, anspornen und ich würde mich auf den neuen Tag freuen. Warum ist Azime eigentlich nie erschöpft? Kommt erst im Morgengrauen aus dem Krankenhaus nach Hause, deckt den Frühstückstisch schickt das Kind in die Schule und ihren Derviş an die Kasse. Anscheinend liebt sie ihre Arbeit ebenso sehr wie sie diesen Jesus liebt, nie beklagt sie sich, aber irgendwie schafft sie es einfach nicht, ihren Mann mit dieser Liebe, dieser Lebensfreude anzustecken. Ja, ja, klar würde Derviş aufstehen, natürlich würde er das, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil er am Leben und an seinem Sohn hing, dem Kind auf das sie jahrelang sehnlich gewartet hatten, weil er es ihm schuldig war, aufzustehen.
Und Derviş stand auf. Doch was er da sah, war nicht der düstere Kundenraum, der sein Gefühl ein Versager zu sein stets noch verstärkte, sondern der Himmel. Zwei an der Unterseite schnurgerade Haufenwolken zogen über die Stadt dahin. In Kürze würde er den Platz überqueren, wie jeden Tag, würde in die Hauptstraße einbiegen, die diesen Platz kreuzte und danach in die Nebenstraßen; er würde sich durch die düstere, gereizte, hektische, zielstrebige Menschenmenge schieben, würde sich fragen, warum es diese Menschen so eilig hatten, und sich ärgern, dass er ihretwegen vielleicht den Bus verpassen würde. Aber wider Erwarten war er gar nicht wütend, und die Stadt, durch die er sich zu bewegen glaubte, war gar nicht vorhanden. Derviş blickte über ein Weizenfeld, auf dem die gelben Ähren sanft wogten. Wie ein grüner Klecks stand inmitten der Ähren ein Baum. Gleich einer Oase in der Wüste, schien der Baum weder unter der Hitze zu leiden, noch Freude am leuchtenden Gelb um sich her zu empfinden. „Ahhh! Welche Erlösung! Jetzt bin ich frei! Endlich frei und unabhängig!“ Aber eine innere Stimme warnte ihn: „Du wirst fallen, du wirst von diesem Baum herunterfallen!“, und tatsächlich taumelte er, fühlte einen starken Sog, der ihn nach unten zog…
Er schreckte aus dem Schlaf hoch. Sogleich kniff er die gerade erst geöffneten Augen wieder zu. Gleißendes Licht hatte ihn geblendet, sein Herz raste. Er lauschte dem eigenen Herzschlag und öffnete die Augen wieder ganz vorsichtig, um sie allmählich ans Licht zu gewöhnen. Er ließ die Bettdecke los, an die er sich krampfhaft geklammert hatte.
Draußen vor dem Fenster erstreckte sich ein strahlend blauer Himmel ins Unendliche und umrahmte die Bergkette, deren Gipfel weiße Hauben trugen. Das Gras an den Berghängen stand nach dem abendlichen Regen noch dichter, noch leuchtender, fast als wollte dieses Grün mit den weißen Felsen wetteifern. Irgendwie wunderte er sich über diese Lebenskraft. Dieses Grün. Ihm fiel auf, dass er sich eigentlich schon seit Tagen darüber wunderte. Vielleicht war er an dieses Grün hier einfach nicht gewöhnt. Vielleicht kannte er nur die sengende Hitze und den Herbst, der den Sommer, kaum dass er begonnen hat, wieder in die Knie zwingt. Erneut erschienen ihm die Ähren und der grüne Baum aus seinem Traum, und seine übernächtigten verklebten blauen Augen fielen wieder zu. Diese Traumlandschaft kam ihm vor, wie ein seit Langem verlassener Ort, an den man zurückkehrt und alles haargenau wieder so vorfindet, wie es verlassen wurde. Die säuselnden Blätter am Baum, die gelben Ähren, den Moment des erleichterten Aufatmens nach der erstickenden Hitze. War das Glückseligkeit, oder nur die abgestumpfte Gleichgültigkeit eines Betrachters, den alles kalt lässt?
Von irgendwoher im Haus waren Geräusche zu hören, das Schlurfen von Pantoffeln näherte sich. Dann hörte er Azime rufen, ungeduldig und missmutig nach mehreren vergeblichen Versuchen: „Derviş!“
Er schlug die Decke zurück, setzte sich auf und warf einen Blick zur Tür, die nur angelehnt war. Seine Frau war nicht zu sehen, doch er konnte ihr Gemurmel hören und wie sich ihre Schritte wieder entfernten.
Während er so aufmerksam lauschte, fühlte er ein unangenehmes Ziehen im Mund, seine Miene verdüsterte sich. Behutsam ließ er die Zunge über das Zahnfleisch gleiten. Ein Zahnhals lag fast frei; es schmeckte nach Blut. Sogleich zog er die Zunge wieder zurück, als hätte er Angst, einen im Hinterhalt lauernden Feind aufzuschrecken. Aber er konnte der Versuchung nicht widerstehen; diesmal tastete er mit dem Finger nach dem schmerzenden Zahn. Der Schmerz pochte nun als wäre der gesamte Mund ein einziger Wundherd. Weil er meinte, dem Schmerz damit trotzen zu können, stieg er eilig aus dem Bett; beim Aufstehen schwankte alles, er mit dem Zimmer, das Zimmer mit den Bergen. Er blieb stehen, wartete ab. Vielleicht würde der Schmerz ihn ja vergessen, wenn er so reglos verharrte. Als sein Blick auf das Smartphone auf dem Fensterbrett fiel, vergaß er seinen Zahnschmerz. Er nahm es und schaltete es ein. Es war schon nach Neun. Wieder hörte er jemanden sprechen. Er setzte sich in Bewegung, zog die angelehnte Tür auf und stahl sich ins Wohnzimmer. Nach ein paar Schritten lehnte er sich an den Pfeiler mitten im Zimmer und spähte von dort aus dem Fenster.
Das erste, was er ausmachen konnte, war die Front eines bordeauxroten Wagens hinter ihrem eigenen Auto, das an der Einbiegung zu ihrer Zufahrt parkte, die er spätestens kommende Woche pflastern wollte. Dann lenkte er seinen Blick auf die Terrasse, wo er den Rücken eines Mannes und den Nacken einer Frau mit dunkelblondem, schulterlangem Haar erkennen konnte. Der zierliche Kopf und die hängenden Schultern verliehen der Frau etwas Mädchenhaftes. Erst hörte er nur wie Azime sagte: „Bitte, nehmen Sie doch Platz!“, dann sah er sie auch, mit ihren kurzen Haaren.
Azime ging der Frau nur ein wenig über die Schulter. Einen Moment lang wunderte sich Derviş wie klein seine Frau war, als hätte er vergessen, dass sie nur Einsfünfundfünfzig groß war. Gut, aber wer war die Fremde? Dann fiel ihm wieder ein, dass heute die Verstorbene aus Deutschland eintreffen sollte. „Warum kommen die denn zu uns?“, überlegte Derviş. Als sich die Frau herumdrehte, um sich auf die gepolsterte Bank zu setzen, die ihr Azime angeboten hatte, konnte er ihr Gesicht sehen. Sie war gar nicht mehr so jung. Ihr Gesicht wirkte müde, etwas verhärmt und voller Kummer.
Fremd. Ja, richtig, sogar ihr Kummer wirkte hier fremd. Derviş rieb sich die verklebten Augen und ging ins Schlafzimmer zurück, wo sein Blick am Kommodenspiegel hängenblieb. Sein eigener Anblick kam ihm fremd vor, als sähe er einen heimlichen Schnappschuss von sich zum ersten Mal. Ein mürrisches Gesicht mit meliertem Dreitagebart, grauem, spärlichem, gewelltem Haar, buschigen Augenbrauen und Tränensäcken. In seiner Jugend hätte so ein verlottertes Äußeres noch liebevolle Zuwendung hervorgerufen, heutzutage jedoch, wo jeder nur nach Schönheit lechzt, begegnete einem aus den Augen der anderen eher der Ausdruck von Gleichgültigkeit, wenn nicht gar des Ekels. Ah, diese Zahnschmerzen. Wieder dieser unerträgliche Schmerz, der ihm fast das Gesicht nach hinten zog, als läge dort irgendwo seine Seele an einem ihm selbst unbekannten zentralen Punkt.
Als sich nun erneut Schritte näherten, ging er vom Spiegel hinüber zu seiner Kleidung, die neben den weißen Gardinen und beigefarbenen schweren Vorhängen über dem Bügelbrett hing. Neben der dunklen Leinenhose, entdeckte er ein schwarzes Hemd, das Azime offensichtlich für heute gebügelt hatte. Flink entledigte er sich seiner Schlabberhose und schlüpfte in die Leinenhose. Wieder sann er darüber nach, wer wohl die Frau da draußen sein mochte. Klar, er kannte sie nicht… Aber die Verstorbene hatte ihm ja auch nicht so nahegestanden, dass er jeden hätte kennen müssen, der ihr das letzte Geleit gab. Er erinnerte sich nicht einmal mehr daran, wann er die Verstorbene zuletzt gesehen hatte. Er wusste eigentlich nur aus den lebhaften Schilderungen seiner Mutter, dass die Verstorbene und sie derselbe Jahrgang waren, dass sie mindestens vierzig Jahre lang in Deutschland gelebt hatte, dass seine Mutter seit jeher ihre Tüchtigkeit und ihre Sparsamkeit gerühmt hatte, und dass die beiden unzertrennlich gewesen waren. Aber das war es dann auch schon. Irgendwann hatten sie sich aus den Augen verloren. Von Ali hatte er erfahren, dass die alte Frau vor einem Jahr einen Schlaganfall erlitten hatte, ans Bett gefesselt gewesen war und schließlich tags zuvor gestorben war.
Gedankenverloren angesichts dieser stillen, weiten Berge, die dem Menschen ein Gefühl der Unerreichbarkeit vermittelten, knöpfte Derviş sein Hemd zu, da ging die Tür auf und Azime kam herein.
Seine Frau sah ausgeschlafen und erholt aus; wieder herrschte in ihrem kindlichen Blick so eine Alterslosigkeit. Ihre geringe Körpergröße, ihr rundliches Gesicht, genauso wie ihre Kulleraugen ließen sie seit Jahren jünger aussehen, als sie tatsächlich war. Nachdem sie auch noch ein paar Kilo abgenommen hatte, wirkte ihre gesamte Erscheinung geradezu kindlich. Derviş machte das irgendwie nervös. Diese Erscheinung klagte ihn an: “Du bist so faul, streng dich mehr an! Du bist so langsam, mach mal schneller! Du bist so griesgämig, freu dich doch mal ein bisschen! Du hast mich in dieses halbfertige Haus hier gebracht, bei dem noch nicht mal der Rohbau fertig war, und wenn ich dich machen ließe, würdest du in dieser Bruchbude noch bis zu deinem letzten Stündchen so weitermachen, als gäbe es nichts anderes im Leben als deine Setzlinge.”
“Derviş“, sagte Azime, „wir haben eigenartigen Besuch bekommen. Aus Istanbul. Eine Frau mit ihrer Tochter… Sie sind hier, weil sie den letzten Wunsch des Bruders der Frau erfüllen wollen.“
„Bruder? Was für einen Wunsch? Und was haben wir damit zu tun?“
„Nein, mit uns nichts, aber… bevor der Bruder gestorben ist, soll er verfügt haben, dass er hier beerdigt werden will. Aber weißt du, was das Komische daran ist? Sie kommen gar nicht von hier, sie sind schon eine Ewigkeit in Istanbul ansässig. Die Frau ist zum ersten Mal hier.“
„Und…?“
„Mehr weiß ich auch nicht. Sie sind ja gerade erst gekommen, zusammen mit einem jungen Mann, einem Sohn von den Bektaş‘, wie er sagt. Erkan heißt er.“
„Erkan… Erkan Bektaş… Meine Güte, hätten die nicht gleich zum Ortsvorsteher fahren können? Was in aller Welt wollen sie denn von uns?“
Azime zuckte die Schultern, wie um zu sagen, „woher soll ich das wissen“, eilte aus dem Zimmer und ließ die Tür offenstehen. Derviş setzte sich langsam in Bewegung und rief ihr hinterher: „Ich wasche mir noch schnell das Gesicht, dann bin ich auch da.“ Da merkte er, dass seine Zahnschmerzen weg waren.
Der letzte Wunsch eines Atheisten
Die Frau und ihre etwa zwölf, dreizehn Jahre alte blasse Tochter saßen auf der Polsterbank. Der mittelgroße junge Mann im Samtsakko und angehender Glatze, Erkan, lehnte rauchend am eisernen Terrassengeländer. Sowie Derviş mit den Worten: „Herzlich willkommen!“ auf der Terrasse erschien, drehten sich die drei zu ihm um, als wären nun endlich all ihre Probleme gelöst: Der junge Mann, ratlos, wohin mit seiner Zigarette, die Frau, mit dunklen Augenringen, das Mädchen, so blass, als flösse kein Tröpfchen Blut durch ihre Adern. Es blickte gleichgültig drein, vielleicht hatte es ja irgendein Teenagerproblem. Die gepflegten dunkelblonden offenen Haare der Frau, die an den Spitzen fast hellblond waren, passten irgendwie nicht zu ihrem kummervollen Gesicht.
Derviş beugte sich nach vorne und drückte zuerst der Frau und dann dem Mädchen die eiskalten Hände. „Mein Beileid!“
Erkan, der Derviş so überschwänglich die Hand schüttelte, als würden sie sich schon seit einer Ewigkeit kennen, fügte noch schnell hinzu: „Mein Vater hat uns gesagt, dass du vielleicht hier bist. Deshalb schauen wir bei euch vorbei.“ Er deutete mit dem Kopf in die Richtung des Wagens mit dem Anhänger am Straßenrand, dann, als hätte er bereits genug geredet und als wäre es nun an der Zeit das Wort abzugeben, sah er wieder hinüber zu der Frau auf der Bank.
Derviş konnte sich an Erkans Vater noch erinnern. Doch während er nicht einmal wusste, was dieser Musa Bektaş, der seit vielen Jahren in Adana lebte, jetzt machte, nicht einmal, wie viele Kinder er hatte, war Derviş keineswegs erstaunt darüber, was dieser anscheinend über ihn wusste, es war ja auch unschwer zu erraten, was hinter seinem Rücken alles über ihn geredet wurde. Die Dorfbewohner wussten genau, wie sie die anderen im Auge behalten konnten, ohne einander zu sehen, und wie sie dem Betreffenden am Ende die Gerüchte über ihn, ohne Namen zu nennen, hintenherum unter die Nase reiben konnten. Vermutlich tratschten sie über ihn: “Der hat sich doch schon immer vor der Arbeit gedrückt und sich nur den Hintern plattgesessen.“ Das lästerten sie ja nicht nur hinten herum, es gab sogar welche, die es ihm mitten ins Gesicht sagten. „Jetzt wartest du wohl noch die vier Jahre ab, bis sie dir deine Rente auszahlen. Dein Sohn studiert ja jetzt, aber du, was machst du? Hängst mir nichts, dir nichts deinen guten Job an den Nagel und ziehst ins Dorf.“
„Entschuldigen Sie bitte, wir kommen sicher ungelegen!“, sagte die Frau, „Ich bin Yeşim, und das ist meine Tochter. Die Sache mit meinem Bruder hat uns völlig unerwartet getroffen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Aber ich hätte es nicht übers Herz gebracht, ihm seinen letzten Wunsch nicht zu erfüllen.“
Derviş hatte in seinem Leben schon so viel gehört, so viel erlebt und sich über so vieles gewundert, dass er der Auffassung gewesen war, dass ihn nichts mehr aus der Fassung bringen konnte: Männer, die andere mit Schwertern enthaupteten, religiöse Gruppen, die Frauen auf dem Markt verkauften, Mörder, die im Namen des Glaubens den halben Erdball und sich selbst gleich mit in die Luft sprengten, Perverse, die sich an Kindern, ja sogar an Babys vergingen; all diese Dinge, hatte er bereits ihm Fernsehen und in den sozialen Medien gesehen, oder irgendwo davon gelesen, und sich gedacht, dass das alles nicht wahr sein könne. In seiner Stadt hatte es Anschläge gegeben, er hatte gehört, dass die Häuser von Verwandten mit Kreuzen markierten worden waren, da war es ihm kalt über den Rücken gelaufen. Und trotzdem bestürzte ihn der Tod immer wieder. Vielleicht auch, weil er ihm noch bevorstand. Jetzt allerdings wunderte er sich eher darüber, dass es eine Frau, für die die Sonne quasi gnadenhalber den morgendlichen Frühlingsfrost abgeschüttelt hatte, und eine Jugendliche deren unbeteiligter Gesichtsausdruck jeden Augenblick von Kummer in Scham umschlagen konnte, in diesen Erdstrich verschlagen hatte.
Erkan, der sich nun auf einen Stuhl niederließ, berichtete: „Ich habe mit Olcay den Militärdienst gemacht. Sechs Jahre ist das jetzt her. Wir taten Dienst in der Stadt, im Offizierskasino. Er war ein gebildeter Mann. Viel redete er nicht, aber wenn er redete, dann hörte man ihm gerne zu. Manchmal, wenn wir zur gleichen Zeit frei hatten, zogen wir gemeinsam los, bummelten durch die Stadt oder mieteten uns auch mal ein Auto und machten Ausflüge. Ihn beschäftigte immer die Frage, ob es Gegenden gibt, die für den Menschen unerreichbar sind, die er nicht beschmutzen kann. An einem Wochenende holte ich ihn ab und nahm ihn mit in diese Gegend, von der mein Großvater unentwegt erzählt hat. Das war auch um diese Jahreszeit. Damals, Derviş, gab es hier noch keine Rückkehrer und niemand hatte sich ein Haus gebaut, so wie ihr. Die Felder lagen brach, die meisten Häuser im Dorf waren verwahrlost, es war still, wie ausgestorben. Wir ließen das Dorf hinter uns und fuhren dann den Berg hinauf. Eine Weile blieben wir dort oben und betrachteten die Bergkette. Olcay richtete den Blick hinunter ins Tal, dann wieder hinauf zu den Bergen, zu den weißen Felsen. Er kam gar nicht aus dem Schwärmen heraus: ‚Wunderschön ist es hier, was für ein außergewöhnliches Licht‘. Für mich war das nur ein öder, verlassener Flecken Erde in einer kargen Berglandschaft. Na ja, ich war damals einundzwanzig, kam gerade frisch von der Uni und war zu der Zeit ein ziemlich unbedarfter Typ, ich hatte noch keinen Sinn für so etwas. Er jedoch liebte diese Gegend hier, aber ehrlich, dass das so weit ging, das hätte ich nicht gedacht.“
Erkan schwieg einen Moment und seufzte. Er zog den Ellbogen vom Tisch, rückte sich zerknirscht auf dem Stuhl zurecht und faltete für einen Moment die Hände im Schoß. Dann erzählte er betreten weiter, als trüge er eine Mitschuld an der Entscheidung eines Verstorbenen und als wollte er jede Verantwortung von sich weisen: „Eigentlich hatten wir keinen Kontakt mehr, außer dass wir über die sozialen Medien befreundet waren, dann rief Yeşim gestern an. In der letzten Zeit hat er auf seinem Account nicht mehr viel gepostet. Nur einmal noch, das war vor ein paar Monaten, da habe ich auf seiner Seite ein Foto von diesen Bergen hier gesehen. Darunter stand ein Spruch: ‚Im Leben kann sich der Mensch zwar von der Natur abkehren, im Tod aber kehrt er wieder zu ihr zurück‘. Und ich Trottel habe den Beitrag auch noch gelikt. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass …“
Als Erkan schluckte und schwieg, fuhr Yeşim fort: „Kurzgesagt, Derviş, mein Bruder Olcay hat Selbstmord begangen. Bevor er sich erhängt hat, schickte er Erkan und mir jeweils einen Brief. Krank war er nicht, er war Ingenieur und hatte einen guten Job. In dem Brief stand, dass er diese Welt nicht länger erträgt, dass er seinem Leben selbst ein Ende setzen und dort mit Blick auf die Berge begraben werden will. Und Erkan hat uns dankbarerweise hierhergebracht.“
„In Ordnung“, sagte Derviş, aber eigentlich wusste er selbst nicht so genau, warum er das sagte. War es denn überhaupt möglich, jemanden an einem x-beliebigen Berg zu begraben? Brauchte man dafür nicht eine Genehmigung? Musste man nicht die Gemeindeverwaltung informieren?
Mit all diesen Fragen im Kopf sah er zu seiner Frau hinüber, die gerade mit einem Tablett voller dampfender Gläser und Tassen herauskam. Als könnte Azime Gedanken lesen, sagte sie: „Jetzt gibt es erst einmal etwas Heißes zu trinken und einen Happen zu essen, danach rufen wir den Dorfvorsteher an!“ Sie reichte dem Mädchen eine große Tasse: „Du hast Glück, wir hatten noch Kakao da.“ Dann fragte sie, während sie Yeşim den Kaffee vorsetzte: „Nach welchem Ritus wollt ihr ihn denn beerdigen?“
„Mein Bruder war Atheist. In seinem Brief steht, dass er keinerlei religiöse Zeremonie wünscht. Wir haben die Leiche trotzdem gewaschen, nach der Autopsie im Krankenhaus. Wenn ihr mich fragt, wie gläubig ich bin, dann habe ich keine Antwort darauf, jedenfalls wurde gestern in der Moschee sogar noch das Totengebet gehalten, und heute Morgen sind wir gleich mit dem ersten Flugzeug…“ Ihr Satz endete in ersticktem Schluchzen. Azime bedeutete ihrem Mann, das Tablett zu übernehmen, ließ sich auf der Armlehne der Bank nieder, neigte sich der Frau zu und legte ihr den Arm um die Schultern. „Das war schon gut so. So eine Beerdigung ist schließlich nicht nur für den Verstorbenen da.“
Während Derviş Erkan eines der Teegläser reichte und die übrigen auf den Tisch stellte, verfolgte er, wie mütterlich und fürsorglich seine Frau war, was ihn immer wieder aufs Neue überraschte und ihn, so wie jetzt, die Kindlichkeit ihres Gesichts vergessen ließ. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie ganz umstandslos selbst eine Frau wie Yeşim in den Arm nehmen und an sich drücken konnte, die ihm sowohl in ihrem Schmerz, als auch in ihrer Unnahbarkeit so fern, so unerreichbar schien, hing wahrscheinlich mit ihrem Beruf zusammen. Immerhin hatte Azime seit dem achtzehnten Lebensjahr, also schon fast dreißig Jahre lang, immer dann mit Menschen zu tun, wenn diese Schmerzen litten und am verletzlichsten waren. Doch jenseits dieser Selbstverständlichkeit, dieser Professionalität lag es sicher auch einfach daran, dass sie zu tiefem Mitgefühl fähig war. Vielleicht hatte auch ihre jahrelange Glaubenssuche – oder eher Identitätssuche – sie schließlich zumindest zu einem Entschluss geführt: Gut zu sein. Sich das Gutsein zur Maxime zu machen. Gut zu sein, um sich vor dem Schlechten zu schützen. Gut zu sein, um geliebt zu werden. Gut zu sein, um Seelenfrieden zu erlangen. Aus diesem Grund war sie mit Derviş hierhergekommen, damit er seinen Traum verwirklichen konnte, ein Haus zu bauen und Mandelbäume zu ziehen. Und damit nicht genug, obwohl sie den Rentenanspruch voll hatte und schon ihre Rente bekam, nahm sie zu Beginn des neuen Schuljahres eine Stellung in einer Schwesternschule an, die zudem noch über siebzig Kilometer weit entfernt lag. Die Oberschwester Azime unterrichtete von da an dreimal die Woche Schwesternschülerinnen, und zwar nicht nur darin, gute Krankenschwestern zu werden, sondern auch gute Menschen.
Dabei war Azime vor Jahren, als sie noch auf ihrer Suche war, leicht reizbar, verschlossen und in sich gekehrt gewesen. Dann ein paar Jahre nach ihrer Heirat, fing sie an, immer wieder von Gott, Jesus und der Bibel zu sprechen. Derviş bekam erst viel später mit, dass Azimes ältere Schwester, die in Istanbul lebte, eine getaufte Protestantin war. Azime besuchte ihre Schwester in Istanbul sehr häufig, von Zeit zu Zeit nahm sie auch Derviş mit. Bisweilen erinnerte sich Derviş an einen Sonntag, an dem sie die Schwester in Kadiköy besuchten. Wie seine Frau im schicken schwarzen Kleid zusammen mit ihrer Schwester zur Kirche aufgebrochen war, und wie er den beiden lange Zeit hinterhergeschaut hatte. Ein merkwürdiges Gefühl von Fremdheit war das gewesen, Azime veränderte die Welt, und er fühlte sich im Stich gelassen. Dabei hatte er wie jeder im Dorf von Anfang an gewusst, dass seine Frau sowohl von der Vater-, als auch von der Mutterseite armenische Wurzeln hatte. Das war bekannt, aber im Alltag hatte es keine Rolle gespielt, der Glaube war eher wie ein Name, der eben von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Azime hatte schon seit jeher an den Sonntagen eine Kerze angezündet, im Frühling Hefeteilchen gebacken und in der Nachbarschaft verteilt, aber Derviş hatte das nie mit irgendeiner religiösen Praxis in Verbindung gebracht, sondern damit, dass seine Frau eben einen Sinn für solche Details hatte, ja sogar eine gewisse Veranlagung zur Selbstdarstellung. Dann war es irgendwann so weit, dass sie gut sichtbar eine Marienfigur mit Kind aufstellte und hinter der Kerze eine Bibel in einem Stoffbeutel an die Wand hing. Derviş hatte diesem Treiben eine Weile mit einer gewissen kindlichen Spielfreude zugesehen, dann war er dazu übergangen, an seiner Frau herumzunörgeln: „Jetzt übertreibst du es aber wirklich!“, nachdem das nichts nutzte, wurden sie einander allmählich immer fremder, und er überließ sie ihren Ritualen, ohne noch etwas dazu zu sagen. Später begann er, sich für die Welt seiner Frau immer mehr zu interessieren. Mit der Zeit verstand er mehr von dem, was er über das Christentum gehört hatte. Er lernte Protestanten von Katholiken, und diese von Orthodoxen zu unterscheiden und war neugierig auf die Geschichten über wundertätige Ikonen, die er in Büchern entdeckte, die Kreuzigung Jesu, die Dreifaltigkeit und die historische Einordnung dieser Dinge. Das ging so weit, dass Derviş, ausgehend von den Kerzen in einem zwanzig Quadratmeter großen Schlafzimmer, einer Marienfigur und einer Bibel, die nie von der Wand genommen wurde, aufbrach ins Istanbul der Byzantiner, ins Mittelalter, von da in die Renaissance und von einer Kirche in Kadıköy bis nach Rom und von dort wiederum bis zum Kölner Dom. Azime jedoch blieb allein mit dem Gebet, das sie von ihrer Schwester und in der Kirche in Istanbul gelernt hatte, in die sie ein, zwei Mal im Jahr ging, blieb allein mit den Kerzen in der Zimmerecke, und interessierte sich weder dafür, was Derviş an Wissen angehäuft hatte, noch wollte sie mit ihm darüber diskutieren, womit er sich auseinandersetzte. Dieses Wissensbombardement hätte ihre schlichte Weltsicht überstiegen, hätte sie verstört und erschüttert.
Später jedoch musste Derviş sich selbst eingestehen, dass es für den Bruch zwischen ihnen noch einen weiteren Grund gab: Der unerfüllte sehnliche Kinderwunsch hatte Azime zum Glauben, zum Gebet gebracht; Derviş brachte ihr Gebet zur Historik und zu Bildung; doch das, was sie einander hätte näher bringen können, ließ sie einander noch fremder werden. Als Azime Derviş dann eines Nachts auch noch aus seinem süßen Schlummer riss und ihm ankündigte, sich taufen zu lassen, zementierte sie dieses Fremdwerden regelrecht. Sie hatte das in einem so entschiedenen Tonfall vermeldet, als würde sie eine Urkunde verlesen. Und wie aufgebracht sie war. Für ihn hatte sich das Gerede von der Taufe so angehört, als hätte sie gesagt: „Ich lass mich scheiden!“ und: „Es reicht, du kannst mir ja nicht mal ein Kind machen!“. Auf wen oder was hätte Derviş eigentlich wütend sein können? Auf seine Frau, sein eigenes Unvermögen? Oder auf die Wissenschaft? Denn während zu früheren Zeiten bei einer ausbleibenden Schwangerschaft, einzig und allein die Frau beschuldigt wurde, nicht fruchtbar zu sein, sind nun, wie längst vermutet, auch die Männer als Schuldige entlarvt. Derviş hatte nämlich zu wenige Spermien, sie hielten nicht lange genug durch, erreichten nicht die Eizellen. Eigentlich wäre es unter diesen Umständen nötig gewesen, dass er sich mithilfe eines Sex-Films einen herunterholte und seine erbärmlichen Spermien in einen Glasbecher ejakulierte, damit der Arzt sie dann in die Eizelle seiner Frau injizierte. Hätte Derviş damals auch nur ansatzweise die Sprache der Bienen und der Natur verstanden, dann hätte es ihn vielleicht etwas entspannt, vielleicht sogar amüsiert, dass der Arzt als Befruchter den Eindruck vermittelte, er sei eine Arbeiterbiene – so von Blüte zu Blüte wandernd, vom Männchen nehmend, dem Weibchen gebend. Für Derviş war dieser Vorgang nichts als nur peinlich. Deshalb hatte er diese Peinlichkeit immer vor sich hergeschoben und gehofft, das Wunder würde sich von selbst ergeben. Und wie auch immer, es passierte tatsächlich, das Wunder geschah von selbst, ohne dass der Vereinigung mit künstlichen Mitteln nachgeholfen werden musste. Zwei Wochen nach ihrer mitternächtlichen Direktive verkündete Azime, dass sie schwanger sei. Endlich kam dann ihr Sohn zur Welt und die beiden hatten jene Nacht vergessen. Seine Frau sprach ohnehin seit langem nicht mehr mit ihm über ihren Glauben, und auch ihre Kette mit dem Kreuz, das immer unter der Kleidung versteckt gewesen war, trug sie nicht mehr. Erst hatte die Religion sie jahrelang in ihrem Bann gehalten, aber dann hatte sie ihre Magie verloren wie eine abgeflaute Liebe. Oder Azime hatte mit ihrem Gott verabredet, dass sie ihr Gebet verrichtete, indem sie Menschen berührte.
Gedankenverloren führte Derviş das Teeglas an den Mund und nippte daran, da durchfuhr ihn wieder dieser schon in Vergessenheit geratene pochende Zahnschmerz. Er verzog das Gesicht und stellte das Glas wieder zurück auf den Tisch. Tee auf nüchternen Magen, das war jetzt sowieso nichts, oder? Er dachte ans Frühstück und sah wieder zu den beiden Frauen hinüber. Yeşim hatte aufgehört zu schluchzen und griff nach ihrem Nescafe. Azime, die immer noch auf der Lehne saß, kniff die Augen zusammen, blickte zur Straße hinunter und raunte: „Derviş, so wie es aussieht, wird da gerade die Leiche gebracht, auf die Ali mit seiner Familie wartet.“
Auf der Bezirksstraße rollten langsam unmittelbar hintereinander ein paar Fahrzeuge heran. Am Dorfrand liefen die Menschen zusammen. Sie sahen auf die Straße, hatten aber zugleich auch Derviş‘ Haus im Blick.
„Habt ihr auch einen Todesfall?“, fragte Yeşim.
„Nun ja, nicht wir… eine alte Frau aus unserem Dorf, sie hat aber im Ausland gelebt…“ Während Derviş noch erklärte, wurde er abgelenkt. Er hörte etwas. Kam das von drinnen? Ein dumpfes Telefonklingeln. Erkan schob seine Hand in die Sakkotasche, zog ein Mobiltelefon hervor, das jetzt aufschrillte, doch von Erkan sogleich verschämt zum Verstummen gebracht wurde. Dann sprang er hastig auf und noch während er die Terrassenstufen hinuntereilte, rief er erschrocken aus: „Um Himmels willen! Nein, nein, ich bin nicht hingegangen. Ich war gar nicht in der Stadt. Mir ist etwas Wichtiges dazwischengekommen… Habt ihr schon etwas von unseren Leuten gehört? Oh nein, das ist ja schrecklich!“
Als Erkan kurz darauf wieder zurückkam, war er leichenblass, und seine Lippen zitterten, als er stammelte: „Es ist etwas Schreckliches passiert. In Ankara sollte heute eine Friedenskundgebung stattfinden. Aber noch bevor sie anfing, gingen Bomben hoch, es soll Dutzende von Todesopfern geben. Wenn ich heute nicht hierhergekommen wäre, wäre ich auch dabei gewesen.“
Alle schwiegen. Das Einzige, was man vernahm, war das plötzlich deutlich vernehmbare Vogelgezwitscher und das näherkommende Motorbrummen. In der Menschenmenge, die sich am Dorfeingang versammelt hatte, machte sich allmählich Unruhe breit.
Irgendwann brach Yeşim das Schweigen: „Da seht ihr – manche Menschen sterben beim Kampf für ein besseres Leben, andere bringen sich selbst um, weil sie es nicht mehr ertragen können, wie unser Olcay.“ Während sie dies sagte, hatte sie ihre schmale, feingliedrige, gepflegte Hand auf die Schulter ihrer Tochter gelegt. Wie um sich selbst zu trösten und ihre Tochter vor den Abscheulichkeiten des Lebens zu schützen, so empfand es zumindest Derviş.
Derviş dachte noch über die Abgründe des Abscheulichen nach, als er mit Erkan im Schlepptau in der Menge auf dem Dorfplatz nach dem Ortsvorsteher, sowie den Dorfältesten und dem alewitischen Geistlichen suchte, den man zur Beerdigung gerufen hatte. Irgendwie ging ihm der Platz nicht aus dem Kopf, auf dem es den Anschlag gegeben hatte, gleichzeitig dachte er auch immer noch an seinen Traum vom Morgen.
Aus den Mitteilungen, die auf Erkans Telefon eingingen, erfuhr er nähere Details über den Anschlag, stellte fest, dass die Explosion genau zu der Zeit stattgefunden hatte, als er seinen Traum hatte, war verwirrt, betroffen, spürte aber zugleich, dass seine Betroffenheit eher Selbstmitleid war.
III
Sunas Rückkehr
Suna sieht den Körper, der im Schoß der Frau liegt, unter einer Gaswolke verschwinden und verlässt eilig denselben Platz, der auch Derviş nicht aus dem Kopf geht. Sie rennt davon, obwohl sie es eigentlich gar nicht will. So wie man wehrlos ist, wenn einen der Schlaf übermannt und wie man machtlos der Welt des Traums unterworfen ist. „Ich darf nicht gehen, ich muss weitersuchen,“ sagt sie sich, aber eine Kraft, gegen die sie nicht ankommt, zieht sie weg von dort, zu sich heran.
Leere. Leichtigkeit. Bekannte Gesichter, Gegenstände, Häuser, Momente…
Und da erstreckt sich gleich vor ihr eine breite Straße unter dieser Leichtigkeit.
Der Ort kommt ihr irgendwie bekannt vor. Noch in den kühlen Morgenstunden, war sie mit Deniz über diese menschenleeren Bürgersteige geschlendert, zwei schlanke Schatten, die sich als zwei Verliebte in den Schaufenstern spiegelten. Sie waren Hand in Hand dahinspaziert, hatten sich über Gott und die Welt unterhalten und immerzu gelächelt, einfach nur, weil sie sich über ihr Wiedersehen freuten. Dann wurde es allmählich hell, die Straßen füllten sich und nun freuten sie sich darüber, dass sie wegen ihrer Vertrautheit und Nähe zueinander von anderen für ein Liebespaar gehalten wurden. Von weitem war Davul-Zurna-Musik zu hören, und Suna konnte eine lange Reihe von Halay-Tänzern ausmachen. Eine blonde Frau, die vor ihnen ging, drehte sich immer wieder um und lächelte ihr zu. Aber jetzt macht sich Angst breit, und schleichend überzieht diese Angst ihre Freude und legt sich über sie wie eine dünne Haut. Irgendetwas wird gleich geschehen, es wird einen lauten Knall geben, dieses Lächeln wird erstarren und…
Und Suna kehrt um, geht zurück, irgendwohin, ohne zu wissen, wo dieses Zurück eigentlich ist. Auf einem von Bäumen gesäumten Weg weht ihr ein milder Wind durch das Haar, zwischen Bäumen und Hügeln liegt ein See in trübem Blau, der immer mal wieder zu sehen ist und wieder verschwindet. Suna weiß, dass sie auf einem Moped sitzt, weiß, dass das Herz in ihrer fest an Deniz‘ Rücken geschmiegten Brust wie verrückt rast, weiß um das bereitwillige Erwachen ihres Körpers. Dann sieht sie sich im Wasser dieses Sees schwimmen. Sieht wie ihre Mutter, die in einer Bucht am Ufer bei einer der schlammigen, heißen Quellen sitzt, winkt und ruft: „Schwimm nicht so weit raus!“ Zugleich sieht sie den stolzen Blick ihres Vaters, den die Mutter in der Küche ihres Hauses umarmt und ihm berichtet: „Unser Mädchen studiert jetzt an der Universität!“
Nun blickt ihr Vater sie aus einem Spiegel heraus an. Ein junger Mann, schlank, mit schwarzem Haar.
Vor einem großen Spiegel steht eine Frau und betrachtet prüfend das dunkelblaue Kleid, das sie trägt. Die Frau ist zufrieden, mit dem Kleid ebenso, wie mit ihrer gesamten Erscheinung. Hinter der Frau steht ein kleines Mädchen mit offenem Mund und unverwandtem Blick. Suna staunt über die roten Hausschuhe des Mädchens, ihre winzigen Füßchen, die Kulleraugen und die runden Bäckchen. „Was für ein süßes Kind ich doch einmal war!“, sagt sie sich. Ihr Blick ist zugleich der Blick dieses kleinen Mädchens, der auf das Kleid mit den am Rocksaum und der Taille hervorblitzenden Stecknadelköpfen gerichtet ist, vor allem aber auf den Körper der jungen Frau.
Während das kleine Mädchen weiter unentwegt die Frau und das Kleid bestaunt, das der Vater geschneidert hat, wendet sich die erwachsene Suna vom Spiegel ab und schlendert durch diese alte, vom Vater betriebene Schneiderei, die sie schon lange vergessen glaubte und derer sie sich auch jetzt nur vage entsinnen kann. Aber in ihrer Erinnerung ist es weniger eine Schneiderei, als vielmehr ein Spielzeugladen: bunte Stoffe. Futterseiden in beige und grau. Steifleinen, Knöpfe, Nieten, Uniformabzeichen. Scheren, Nadeln, Fingerhüte in sämtlichen Größen, Nadelkissen für die Stecknadeln, an den Wänden aufgereihte Garnrollen. Sie liebt nicht allein diese Dinge an sich, sondern auch ihre Bezeichnungen. Ihr gefällt, dass die festeren Garne Nähseide heißen. Sie ist hin und weg, dass nicht jedes Schneiderlineal nur schlicht Lineal genannt wird, sondern dass man die dreieckigen als Reverswinkel und die geschwungenen als Kurvenschablone bezeichnet, und dass eine Overlock von der normalen Nähmaschine zu unterscheiden ist. Mit der Freude der Fünfjährigen kann Suna sich an diesem Ort unendlich lange aufhalten, mit den Erfahrungen der Zwanzigjährigen, will sie hier Schutz suchen.
Ein vergebliches Unterfangen, das weiß sie. Sie weiß es und sieht, wie sich das kleine Mädchen auf Zehenspitzen hinauf zum Bügeltisch reckt, an dessen einem Ende das Kleid der Frau liegt, und wie sie versucht, die Frau auf einem Stück Papier zu skizzieren. Während der eine Stift mit blauer Farbe in fliegenden Strichen die Zeichnung einer weiblichen Figur mit geschwungenem Kleiderrock auf das Blatt wirft, hinterlässt ein anderer unter dem Ellbogen des Mädchens unversehens lilafarbene Striche auf dem blauen Stoff. Die zwanzigjährige Suna will ihrem fünfjährigen Ich noch zurufen: „Nein, nicht! Schau doch mal, du malst ja das Kleid der Frau an,“… Aber geht das denn? Kann man Geschehenes rückgängig machen? Ist man Herr über die Vergangenheit? Da steht plötzlich der Vater vor ihr, reißt ihr den Stift aus der Hand, wirft ihn zu Boden, ergreift das blaue Kleid und hält es in die Luft. Der Vater, das Gesicht rot vor Wut, als wäre gerade die Welt über ihm zusammengebrochen, lässt die Schultern fallen, senkt den Blick und das Kleid, das er so sorgfältig gehütet hatte, schleift jetzt am Boden.
Immer, wenn der Vater beklagt, dass er seinen Laden aufgegeben hat, oder wenn Suna sich irgendetwas zuschulden kommen lässt, senkt er den Blick auf diese Art und Weise. Es fällt Suna leicht, den Sticheleien der Mutter zu trotzen, ihren Ermahnungen und ihren Ohrfeigen, die sie in Sunas Kindertagen gerne einmal austeilte, aber gegen diesen Blick des Vaters kommt sie nicht an. Ob Papa etwas von Deniz weiß? Weiß er, dass sie ihn angelogen hat, um Deniz zu treffen, dass sie heimlich in diese Stadt gefahren ist, weil sie Deniz liebt und all das, was Deniz liebt?
„Ich muss zurück, ich muss Deniz finden, ich muss jetzt gleich nach Hause ohne jemanden zu wecken,“ sagt Suna, oder war es nur ihre innere Stimme.
Sie schlägt die Augen auf und im selben Moment findet sie sich just auf diesem Platz zwischen all den umherirrenden Menschen wieder. Ein höllisches Menschengewirr. Wehklagen. Sirenengeheul. Aus Rettungswagen gezogene Tragen, auf Tragen gelagerte Verletzte, komplett mit Tüchern bedeckte Körper. Irgendwo, zwischen weißen Kitteln, taucht die Troddel an Deniz‘ blauem Rucksack auf, seine Hand, die immer noch die Plastikflasche hält, und die bunten Bändchen an seinem Handgelenk.
„Deniz!“ schreit sie. „Hier bin ich.“ Doch zugleich begreift sie, dass sie nicht weiß, ob sie schreit oder nicht, ja nicht einmal, ob sie überhaupt irgendeinen Ton herausbringt.
IV
Zahide
Das schallende Gackern einiger Hühner in der Stille, ein Telefon, das in irgendeinem Haus pausenlos klingelt, das geräuschvolle Murmeln eines Häufleins von Menschen, das sich am Ortsrand vor dem Eingang eines zweistöckigen Gebäudes versammelt hat und Stille. Zahide kennt nun in erster Linie diese Stille. Erlöst von allen Lauten, Atemzügen, von allen Bürden wandert sie auf der Scheidegrenze. Wozu gibt es dieses Unkraut, dieses Grün, das Gestein sprengt, aus Rissen hervorbricht und dem Licht entgegenstrebt? Ist das ein Zeichen für Üppigkeit und Vielfalt, oder gerade im Gegenteil für Mangel und Kargheit? Wo sind sie, die Schafe, die früher in ihrem Pferch blökten, die muhenden Kühe, die Hühner, die mit ihrem Gackern die Gärten in Aufruhr versetzten, die lüsternen Hähne, die auf die Gelegenheit lauerten, die Hühner zu besteigen, die Ziegen, die es gewohnt waren, sich mit ihren Hufen auf Berghängen, an den weißen Felsen und auf Gestein zu halten? Sie sind nicht mehr da, diese trotzigen Geschöpfe, ah, diese unvergessenen Bergbewohner… Es gibt sie nicht mehr. Es gibt überhaupt keine Tiere mehr hier, außer ein paar dämlichen Hühnern, die Vetter Ali, wenn er, sobald es wieder wärmer wird und er von seinen Kindern aus der Stadt wieder hierherkommt, stets bei einem der staatseigenen Landgüter kauft, Hühner von denen man nicht weiß, ob sie jemals Eier legen werden, die keine Chance bekommen, sich fortzupflanzen und zu vermehren, weil sie noch im Herbst geschlachtet und gekocht werden. Es gibt auch keinen Hund und keine Katze mehr. Wie ihre Jugend, wie das Leben, überließen auch die Tiere diese Gegend ihrem selbstgenügsamen Dasein, dem vorwitzigen Gras, dem Gestrüpp, den Disteln, dem Bocksbart und den reich knospenden Malven. Nur die Bienen gibt es noch, die von Pflanze zu Pflanze schwirren. Wildbienen, die von Menschenhand unberührt bleiben.
Eben läuft ein drei oder vier Jahre altes Mädchen mit einem Stückchen Brot in der Hand an ihr vorüber, das es wie einen Schnuller an den Mund hält, und jagt hinter Hühnern her, von denen Zahide weiß, dass es sie inzwischen gar nicht mehr gibt. Das Mädchen ist noch klein, und kennt das Leben nur aus Sicht eines Kindes, für das Tiere und Menschen noch gleich sind. Aber bald wird es größer werden, dieses Mädchen, und den Kopf eines Schafes halten, das gemolken wird. Die Großmutter wird ihr sagen: „Die Milch einer frischgebackenen Schafmutter darf nur ihr Neugeborenes trinken, nicht wir!“ Das Mädchen wird erleben, mit welcher Begierde das Lämmchen ungeduldig die Zitzen seiner Mutter anstubst, und wie sich das Schaf beim Melken beruhigt und zutraulich wird, wenn es mit der Hand in sein Fell greift. Sie sieht ganz deutlich das Gesicht des Lämmchens, das des Schafes, der Mutter und der Großmutter, das des Mädchens aber nur verschwommen. Niemand schaut mehr für dieses Kind in den Spiegel, keiner ist mehr da, um sich sein Gesicht anzusehen und sich daran zu erinnern, und es gibt auch kein Foto mehr von ihm auf dieser Welt. Kein Foto, das dieses Mädchen zeigt, wie es aufgeregt vor dem Blech hüpft und sich auf das Lob der Mutter freut, für die sie den Teig für die Fladenbrote selbst geformt hat. Jahre später, als aus diesem kleinen Mädchen eine reife Frau geworden ist, wird sie sich wieder an diesen Moment erinnern, als sie in irgendeinem fernen Land auf die winzigen teigverklebten Hände ihres Enkelkindes blickte. Die Enkelin, die mit ihr in einer fremden Sprache spricht, spielt und so tut, als wäre der Sand auf dem Spielplatz das Mehl, und der Schlamm aus Sand und Wasser der Teig. Das Mädchen aber saß nicht zum Spaß da, sondern um zu arbeiten und um zwölf Jahre lang darauf zu warten, es mit der Geschicklichkeit der Mutter aufnehmen zu können. Es wartet jeden Monat auf einen Schmerz, ein Gefühl der Scham und darauf, heimlich ihre blutigen Stofflappen zu waschen. Damit es nur ja keiner erfährt, Zahide, damit keiner mitbekommt, dass du nun geschlechtsreif bist. Aber sie bekommen es mit, alle bekommen es mit und so wirst du mit vierzehn Jahren verheiratet. Der Preis für eine Heirat mit vierzehn: für immer vergessene Träume, eine verpasste Jugend. Ach, Zahide, leider bist du zu früh geboren, herangewachsen an einem Ort und zu einer Zeit, da sich keiner darum scherte, was eine Frau will. Das war der Grund, warum du deine jüngste Tochter, die sich von ihrem Mann mit den Worten trennte ‚Ich liebe dich nicht mehr‘, einerseits verstanden, zugleich aber auch mit einem angewiderten ‚Pfui!‘ ausgeschimpft hast, weil sie nicht länger duldsam war, sich nicht schämte. Und was für ein Pfui das war! Denn wie wichtig ist dir immer dein Ansehen als Frau gewesen. Du hast doch so viel auf deine Weiblichkeit gehalten. Du hast doch die erlittenen Fehlgeburten als dein Versagen als Frau angesehen, es bedauert, dass du vor den Söhnen zuerst Töchter zur Welt brachtest, und bist dann vor Stolz fast geplatzt, als du deine Söhne geboren hast. Seid ihr nicht auch aus reinem Geltungsdrang ausgewandert? Dein fauler Mann, hätte er gehen können, hätte er es unter all den Fremden ausgehalten? Du warst es, die fortging, Zahide, und auch noch in den entlegensten Winkel der Erde. Die Fabriken, in denen du gearbeitet hast, die misstrauischen Blicke, die skeptisch hochgezogenen Augenbrauen, die Menschen, die einem aus dem Weg gehen… Leg doch das Kopftuch ab, Zahide, schau, selbst deine Kinder schämen sich dafür! Leg es ab, die Moral sitzt nicht im Kopftuch, sondern im Kopf, das weißt du doch selbst! Und du hast es abgelegt. Du hast gesagt: „Man muss sich anpassen, darf nicht auffallen“, und du hast dich gekleidet wie eine Städterin. Du hast gesagt: „Man muss sich gut benehmen!“ Du wusstest, dass es erforderlich war, seine Hand, seine Zunge und seinen Leib in Zaum zu halten. Oder gilt dieser Grundsatz etwa nur für den Mann? Du wusstest, dass die Frau für die Ehre ihres Leibes Rechenschaft ablegen muss. Was, wenn du dich mal umgeschaut hättest, was, wenn du dich in einen gutaussehenden Mann verguckt hättest, Zahide? Wenn du dich verliebt hättest? Wie viele haben der Versuchung in der Fremde nicht widerstanden, warum du? Und so verrinnt die Zeit. Die Kinder werden groß, die Stimmen brüchig und kraftlos, ach, diese verrückten Jahre, keiner will in der Fremde alt werden, sie wollen zurückkehren, gehen fort, nehmen alles mit, kommen zurück, Sehnsüchte, Erwartungen, grau werdendes Haar, Blutungen, die mit Hitzewallungen und Schweißausbrüchen enden, so wie sie einst mit Schmerzen und Scham begannen, Hochzeiten, Enkel, Freuden, Geburtstage, Geschenke, Urlaube, Flugzeuge, Busse, unendlich große Entfernungen, getätigte und erwartete Telefonanrufe, Kinder, ausbleibende Kindesbesuche, Operationen, Zahnweh, Gliederschmerzen, gezogenen Zähne und die Dritten, die nicht ordentlich sitzen, Osteoporose, Schmerzen, Medikamente, Nickerchen, Schmerzen, immer wieder Schmerzen. So bist du immer älter geworden, Zahide, bis dann irgendwann die Welt über dir zusammengebrochen ist. Du sagtest: „Ach, dieses Leben, eine lange Geschichte, aber trotzdem nur so kurz wie ein Wimpernschlag“.
Die Tür eines Hauses, in dem du einen Teil deines Lebens verbrachtest, stieß der Wind auf, und im gleichen Atemzug nahm er dich, Zahide, auf. In diesem Haus sind keine Spuren mehr von dir zu entdecken, nicht aus deiner Kindheit, und auch nicht aus der Zeit, als du ein Mädchen warst oder eine junge Frau. Es wurde umgebaut von Leuten, die die Stadt kennen, die herumgekommen sind in der Welt, Tür und Fensterrahmen sind inzwischen indigoblau gestrichen. Ein unberührtes Bett mit strammgezogener Decke und ein mit einem Laken verhängter Fernseher warten auf ihren Besitzer. Egal welche Haustür der Wind jetzt auch immer aufweht, es erwartet ihn immer das gleiche Bild. Alle, die aus der Stadt anreisen, stellen sogleich ihr Gepäck in eine Ecke und gehen los, um einer Toten das letzte Geleit zu geben. Sie meinen, wenn sie den schmerzgebeugten Körper, aus dem Sarg heben und ihn in die Erde legen, befände sich auch seine Herrin dort. Aber Zahide ist hier, wandelt leicht und frei irgendwo zwischen Sein und Nichtsein, erlöst von ihren Schmerzen, ihren Qualen.
Plötzlich tauchte auf dieser Grenze zwischen Sein und Nichtsein der Umriss eines fahlen Mannes vor ihr auf. Sein glattes Haar war schon etwas schütter und grau, Sein Körper groß und schlank, sein Gewicht schien mehr von den Knochen herzurühren, als von Fleisch und Blut. Er hatte eine Verletzung, das erkannte sie. Sie nahm das blaue Mal wahr, das sich auf der weißen Haut wie ein Halsband um die Kehle zog. Ein Lächeln macht sich auf seinem Gesicht breit, als hätte er sein ganzes Leben lang mit sich selbst gerungen und sei nun zufrieden, endlich frei zu sein.
Sie fand sich wieder, wie sie auf das Haus an einem Feld mit frischgepflanzten, ausschlagenden Setzlingen zuging. Im Obergeschoß des Hauses lagerte Baumaterial, Kohlen und Fliesen, auf der Terrasse beim Eingang standen ein Tisch, eine Polsterbank und Stühle.
Ihre Schritte, oder das, was sie als Schritte kannte, führten sie zielsicher, zuerst in ein großes Wohnzimmer, das ein Pfeiler unterteilte, dann in ein Schlafzimmer. Da stand jemand am Fenster und sah nach draußen.
Zahide, die es leid war durch leere, verlassene Häuser zu ziehen und Steine und Gräser zu betrachten, näherte sich dem Mann zaghaft und sprach ihn an: „Sie haben ihre Häuser verlassen. Aber ganz gleich durch welche Türe ich trete, ihre Schatten sind noch da.“
„Was kümmern mich die Menschen. Die Häuser, diese vier Wände, das alles interessiert mich nicht.“
„Geht das denn, so ohne Haus, ohne Obdach?“
„Ja, ja, das geht. Was bleibt am Ende schon davon übrig? Und ob das geht.“
Sie wollte gerade fragen, wie, ließ es aber dann sein. Würde es nicht auch wieder ihre Gebrechlichkeit auf den Plan rufen, wenn sie nun wieder Freude am Leben zeigte, jetzt, nachdem sie von all ihren Schmerzen befreit war, die sie gequält hatten. Ja gut, aber warum verharrte diese einsame, stolze Seele angesichts dieser Bergkette, die eine ganze Welt beherrscht, worauf wartete sie? Waren es die Berge, zu denen sie sich hingezogen fühlte? Sie wurden besungen, sie waren der Quell von Mythen und Ängsten, diese Berge stehen/standen immer noch unverändert da, wie Zahide sie seit eh und je kannte. Unverrückbar, unveränderbar, unerreichbar. Und dennoch, sie existierten weder um vom Menschen verehrt zu werden, noch um ihnen Furcht oder Schutz zu sein. Ein Berg ist am Ende doch einfach ein Berg, das hatte Zahide immer schon gewusst. Die Erhabenheit der Berge rührte nicht von ihrem Stolz her, sondern von der Erbärmlichkeit der Menschheit.
„Da, jetzt schaust du ja schon wieder zu einem Haus heraus. Ohne Haus geht es nicht. Das weißt du auch.“
„Ich werde gehen. Ich warte nur noch.“
„Wohin, zu den Bergen? Wie heißt du?“
„Was hast du davon, wenn ich dir sage, wie ich heiße, was bedeutet schon ein Name? Werden wir etwa Freunde sein?“
Zahide zog sich zurück. Das war eine von diesen einsamen Seelen, mit denen man nicht weiterkam.
Auf wen hatte Zahide nicht Zeit ihres Lebens schon alles eingeredet, welches ihrer Kinder hatte auf sie gehört, welches hatte getan, was sie wollte, dass sie jetzt meinte, einen Fremden überzeugen zu können? Sie musste raus aus diesem Zimmer, eilte ins Freie hinaus. Von dort auf die Straße, überquerte sie und erreichte ein zweistöckiges Gebäude am Ortseingang, wo sich laut murmelnd zahlreiche Menschen versammelt hatten. Sie drehte sich noch einmal um und warf einen Blick zurück zu dem Haus, in dem sie dem Mann begegnet war, auf das Feld mit den Setzlingen neben dem Haus: „Ach, Cemile, beste Freundin Cemile!“, seufzte sie. „Wo bist du? Hörst du mich? Schau dir mal deinen Sohn Derviş an! Schau, was dein Sohn Dervis, aus dem steinigen Acker gemacht hat, auf den ihn das Schicksal verschlagen hat. Dieser Sohn, den du als tot betrauert hast, über den du dich als wieder auferstanden gefreut hast, hat diesen unfruchtbaren, steinigen Acker in das Paradies verwandelt, das er suchte.
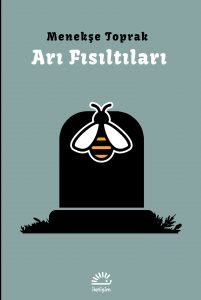
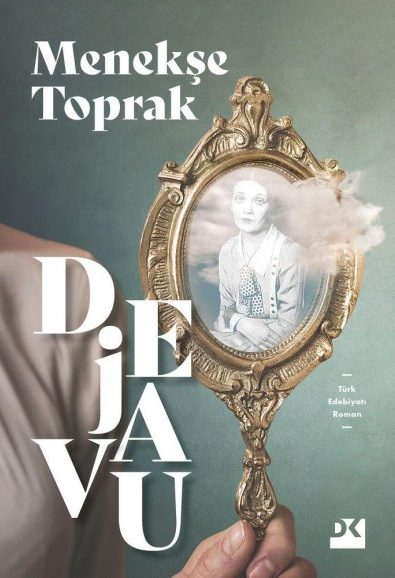




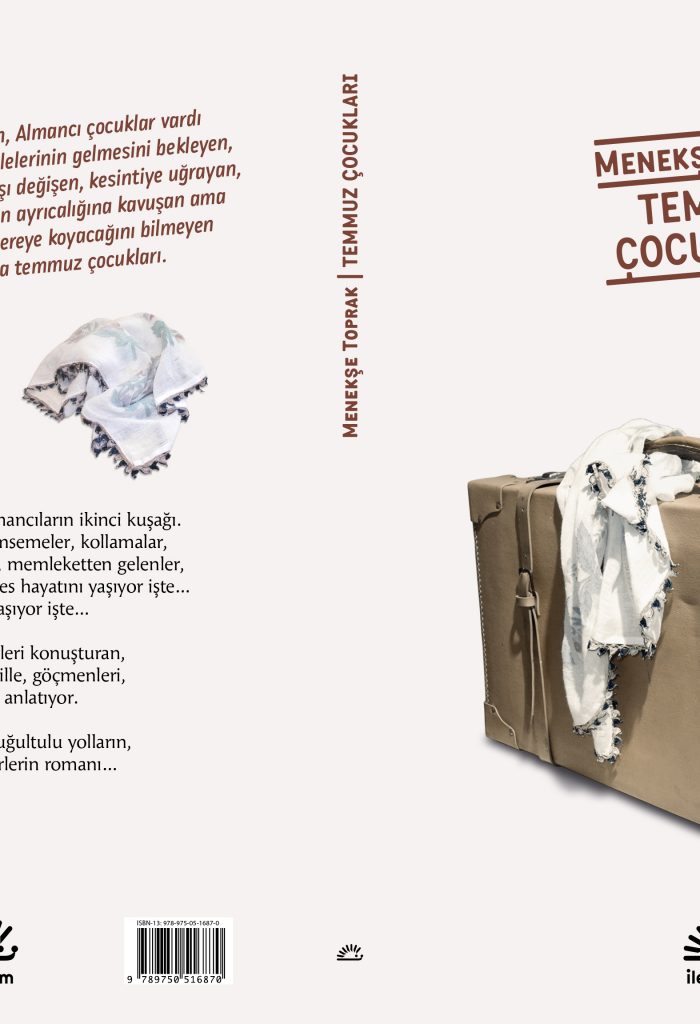

Die Kommentarfunktion wurde geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind noch offen.