Valizdeki Mektup / Der Brief im Koffer
DER BRIEF IM KOFFER
Menekşe Toprak
Während ich im engen Treppenhaus die Stufen hinabsteige, spüre ich plötzlich die Angst der Menschen, die sich mit dem ohrenbetäubenden Lärm der Sirenen in diesen schmalen, halbdunklen Korridor geflüchtet haben. Aber sie ergreift mich nur einen Augenblick lang. Das mindestens sechzig Jahre alte «Pst – Feind hört mit!»-Propagandaplakat an der Treppenhauswand irritiert mich und die Gefühle wechseln die Seite. Erbarmungslos erinnert es mich an Gasmasken unterschiedlichster Größe und Farbe, an Gaskammern, die dürre und nackte Körper wehrlos machen. Der Horror, den die Glasbecher erlebt haben, die erst bei vierhundert Grad schmelzen, mit ihren gebeugten Rücken und den verzerrten Mündern und den ausgebeulten Bäuchen, reicht nicht aus. Wenn ich meine Fantasie anstrenge, schaffe ich es vielleicht, ausgehend von den Glasbechern, die doch nur ein Teil des Tafelzubehörs sind, und den erst verbrannten und dann verrosteten verbogenen Gabeln und Löffeln, mir vorzustellen, wie eine Gabel zwischen den
Fingern einer Hand zum Mund geführt wird, während die andere Hand den Becher liebkost. Es wird reichen, wenn ich sage, dass sie im selben Augenblick wie der Besitzer der Finger, die sie berührten, von Schießpulver und Feuer erfasst wurden.
Dass sich ein einzelner Becher, eine Gabel, ein Messer, zwar in veränderter Form, aber doch im Wesentlichen gleich, erwehrt haben, die schwarzen Skelette der Gebäude, die aus der Asche emporstehen, all das reicht nicht aus, um die Seiten zu wechseln.
Ich begegne anderen Dingen, die mein Gedächtnis befeuern. Die Koffer und Taschen in unterschiedlichsten Größen, die auf dem Boden liegen, erinnern mich zuerst an schwarz-weiße Dokumentarfilme. Menschen gleiten schnellen Schrittes mit den Koffern in der Hand durch die Straßen. Dabei laufen sie gar nicht umher, weil sie auf lange Zugreisen gehen wollen. Sie tragen nur bei sich, was sie von ihren wertvollsten Sachen vor dem Feuer und dem Schießpulver aus ihren Häusern retten konnten, die sie vielleicht nie wieder betreten werden. Das nun kommt mir tragisch vor. Mir ist, als hätte ich etwas verstanden, was sich mir Jahre lang in den Sinn gebrannt hatte und hinter dessen Geheimnis ich nicht hatte kommen können. Ich staune. Nur langsam verstehe ich, und ein bisschen fühle ich es auch. Aber nein, das ist es trotzdem nicht; das sind nicht die Geschichten, nach denen ich suche. Es muss etwas anderes geben. Es kann nicht sein, dass das die Besessenheit ist, die mich an das Ende einer Epoche fesselt, in der alles blass rosarot wird und sich das blasse Rosarot der ersten Farbfilme der ganzen Menschheit bemächtigt. Es sind auch nicht bloß die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Charlie Chaplin, als er bereits seinen torkelnden Krebsgang aufgegeben, seine Bewegungen der wirklichen Erdanziehung überantwortet, sich seiner erzwungenen Taubheit entledigt und eine Stimme gefunden hatte.
Plötzlich kleidet sich alles Schwarz-Weiß in seine wirklichen Farben und die Grau- und Weißtöne der gelockten schönen Frauen mit den kurzen Haaren erscheinen unendlich bunt. Der klitzekleine Koffer, der zuerst durch die Märchen in mein Leben getreten und dessen Existenz dann vor lauter Wirklichkeit vergessen worden war, begegnet mir wieder.
Es ist ein hölzerner Koffer.
Vielleicht war ich damals noch nicht in der Lage, einfaches, billiges Kiefernholz vom Holz des Nussbaums zu unterscheiden, aber ich muss wohl fähig gewesen sein, die Schönheit eines Eichenkoffers zu ermessen, dessen Ränder vernutzt waren und dessen Dunkelbraun an einigen Stellen so verschlissen war, dass sich dort schwärzliche Flecken gebildet hatten.
Ich hatte ihn unbedingt haben wollen. Und zwar auf den ersten Blick. Trotz aller Abwehr durch meine Mutter. Sie hatte mich davon überzeugen wollen, wie unsinnig es war, den Koffer einer armen Frau besitzen zu wollen, die jahrelang einsam gealtert und dann mutterseelenallein gestorben war. Ihr Leichnam war nach einer Woche zufällig gefunden worden, weil die Nachbarn von unten sich vom Lärm des Tag und Nacht laufenden Fernsehers gestört fühlten. Die Einwände waren sinnlos, ich hatte mich nun einmal in ihn verliebt… Dieses Interesse an Altem hat nicht abgenommen. An den Schwarz-Weiß-Filmen nicht, an den Frauen in diesen Filmen nicht, die mit ihren nach innen gedrehten kurzen Locken es nicht satt werden, aus Liebe zu weinen; an den Holzkästchen mit den verzierten Deckeln nicht, an den alten Büsten nicht, deren Wert ich niemals werde erahnen können, an den samtbespannten Sofas nicht mit ihren verzierten Armlehnen, an den schwanengleichen Teekannen nicht und an so vielem anderen auch nicht…
Ich bemerkte ihn beim ersten Mal, als ich mit meiner Mutter in die neu gemietete Zweizimmerwohnung mit einer riesigen Küche ging. Zufällig. Denn wäre ich in der Woche darauf gekommen, wäre von der alten Frau, die in dieser Wohnung gewohnt hatte, nichts mehr übrig gewesen als ein Bild an der Küchenwand, auf dem ein Junge mit Sommersprossen in einem Park ein blondes Mädchen küsst.
Ich war an diesem Abend höchstens eine Stunde in der Wohnung geblieben. Sie war bis oben hin vollgestellt mit Gegenständen. Wir waren zusammen mit meiner Mutter hingegangen, die vollkommen erschöpft von der Arbeit gekommen war und nun meinem Vater klarmachen wollte, dass alles entrümpelt werden müsse und er einen Müllplatz und einen Wagen auftreiben solle. Denn nur in diesem Zustand wollte der Besitzer uns die Wohnung vermieten. Die verstorbene alte Frau hatte keine Verwandten, es hatte sich auch niemand gemeldet, um die Einrichtung zu übernehmen.
Ich erinnere mich, dass meine Mutter an dem Abend vor Wut geschnaubt hat. Sie sagte immerzu: Wer soll uns denn diesen alten Kram abnehmen, wo sollen wir den Schrott abladen? Je mehr Türen des knarrenden Schranks im Wohnzimmer sie öffnete und je mehr Schubladen sie aufzog, desto wütender wurde sie. Mir hingegen gefiel alles: vor dem Fenster, das mit schweren Samt-Vorhängen dicht bedeckt war, ein gelb-bräunliches Samt-Sofa, direkt daneben eine Lampe mit hölzernem Ständer und einem altrosafarbenen Schirm, der schon etwas verblasst war. In dieser Wohnung begegneten mir all die Dinge, die ich aus den Filmen in allen Stufen von Schwarz-Weiß und Grau kannte, zum ersten Mal in ihren eigentlichen Farben.
Mein Vater kam, als meine Mutter vor sich hin sprechend die Küchenschränke durchsuchte. Ich hingegen machte gerade meine eigenen Entdeckungen im Schlafzimmer, das weiter hinten lag. Als ich den kleinen Koffer bemerkte, der neben dem eisernen Bett an der Wand stand, waren meine Eltern ins Wohnzimmer getreten, von dem eine Tür zum Schlafzimmer ging.
Mein Vater: «Schatz, schau mal, dieser Tisch, weißt du, das ist reiner Nussbaum. So etwas kann man nicht wegschmeißen. Das sind Antiquitäten, Schatz, Antiquitäten. Wirklich, ich habe neulich in einem Laden so etwas wie diesen kleinen Sessel da gesehen, du kannst dir nicht vorstellen, was so etwas kostet!»
Meine Mutter daraufhin, genervt: «Ob Antiquitäten oder nicht, das ist mir egal. Ich will nicht, dass meine Kinder mit den was-weiß-ich-wie-alten Überbleibseln einer alten Frau aufwachsen. Und selber benutzen würde ich sie auch nicht. Dann gehe ich lieber los und kaufe mir vielleicht billigeres, aber neues Zeug. Und außerdem haben wir doch genug Sachen, die passen hier auch alle rein.»
Ich fühlte, dass mein Vater darauf bestehen wollte, aber nicht genug Mut besaß. Mein Vater war ein etwas träger Mann. Das nahm ich zumindest an. Viel später erst bemerkte ich, dass das daher rührte, dass er sich nicht ausdrücken konnte in einer Sprache, die er nicht beherrschte. Ich bemerkte es, als wir in der Heimat waren (so nannten sie das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen waren; mir bedeutete es nicht so viel, ich kannte es nur aus den Ferien). Erst als ich selbst erwachsen war, fiel mir auf, dass es nichts mit Trägheit und viel mit etwas ganz anderem zu tun hatte, dass mein Vater, der im Urlaub einen ganzen Monat kaum nach Hause kam und immer etwas erledigte, nach unserer Rückkehr meist nur zwischen der Wohnung und der Arbeit hin- und herpendelte, wenn man mal von den gelegentlichen Besuchen bei Verwandten und Bekannten absah. In diesem Land, dessen Sprache er nicht beherrschte, die er aber auch nicht erlernen wollte, war mein Vater immer ein Fremder geblieben; und in dieser Fremdheit hatte er es sich in der Identität eines verschlossenen, ungelenken Menschen bequem gemacht. Meine Mutter hingegen hatte kaum ein Sprachproblem, weil sie keine Angst vor Fehlern hatte. Sie ging überall ein und aus und beherrschte die hiesige Sprache gut genug, um mit den anderen Frauen in der Fabrik, in der sie arbeitete, tratschen und das Tratschen genießen zu können. Ich erinnere mich, gedacht zu haben,als ich den Koffer, der wie für mich gemacht war, in die Hand nahm, dass es wieder meine Mutter sein würde, die die Ärmel hochkrempelt, wenn es darum ginge, den Nachlass der toten Frau zu entsorgen.
Obwohl er klein war, war es doch ein schwerer Koffer. Vielleicht wollte die alte Frau verreisen,
bevor sie starb, oder sie war verreist und hatte keine Zeit gehabt, ihre Sachen wieder auszupacken. Ich war voll Neugierde und Angst, als ich nach dem alten Schloss griff. Seltsam, so als würde, wenn ich den Koffer öffnete, die alte Frau wie der Geist aus Aladins Lampe aufsteigen, sich wie ein Ballon aufblähen und sich mit ihrer riesigen Statur mir gegenüber aufstellen. Neben der kindlichen Traumwelt spielten natürlich auch reale Ängste eine Rolle bei dieser Zurückhaltung. War es nicht so etwas wie Diebstahl, heimlich die Sachen anderer Leute zu durchwühlen? Dann dachte ich aber daran, dass auch meine Mutter die Schränke durchwühlte und den Inhalt wegwerfen würde. Das beruhigte mich.
Still öffnete ich das Schloss des Koffers, genau passend zum Ein- und Ausatmen meines Vaters, der seufzend an seiner Zigarette zog. Ein rascher Klick. Mit diesem Klick würde ich jahrelang meine Sachen, die ich hier versteckt hatte und die von niemandem berührt werden sollten, erreichen – und mich mit diesem Laut auch wieder von ihnen trennen.
Er war überhaupt nicht so vollgestopft, wie das Gewicht mich hatte meinen lassen. Viele große und kleine Stofftaschentücher. Die Rändelung an den Taschentüchern, die an manchen Stellen schon dünn geworden waren und deren Weiß schon lange verflogen war und nun einem Grau Platz gemacht hatte; bei einigen auch Stickmotive an den Rändern; und dann dieser so bekannte Naphthalin-Geruch. Ganz so wie der von der Truhe meiner Großmutter in der Heimat, wo sich niemand traute ranzugehen. Die Großmutter hatte einst auch solche Taschentücher, so wie auch meine Mutter. Ich hingegen hatte immer Papiertaschentücher.
Und die Hefte. Ich erinnere mich, sie zur Seite gelegt zu haben, nachdem ich versucht hatte, die handgeschriebenen Wörter in einem zu lesen und sie trotz der ordentlichen, nach rechts neigenden Schrift, bei der sie ineinander übergingen, nicht entschlüsseln konnte. Auch die beiden anderen Hefte waren mit der gleichen Handschrift gefüllt. Umschläge, in denen Briefe, Rechnungen, verschiedene Dokumente steckten. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos lächelt immer eine junge Frau mit schulterlangem gelocktem Haar, teils mit Frauen in ihrem Alter, teils in den Armen eines Mannes, der eine Soldatenuniform trägt. Immer schwarz-weiß. Die Hefte, die Fotos, die Briefe, die Briefe… Ich hatte es, alles beiseitegelegt, auf diesen Koffer abgesehen und auf ein ausgeblichenes beigefarbenes Taschentuch mit weißer Rändelung.
Heute staune ich, wie ich diese Sachen wegwerfen konnte, es schmerzt mich, ein Stück Geschichte vernichtet zu haben, ich habe Gewissensbisse. Allerdings war ich kaum eine Woche später, als es darum ging, die Mülltüten zu füllen, tatsächlich arglos; die Schwarz-Weiß-Fotos, die Briefe, einige Bücher, die verwaschenen Taschentücher mit jahrzehntelanger Geschichte wanderten gemeinsam mit all den anderen Sachen auf den Müll.
Ich platzierte die Tüte in einen der Kartons, die meine Mutter in der Diele aufeinandergestapelt hatte. Mein Vater bemerkte mich nicht einmal, als ich an ihm vorbeiging. Er saß schräg auf dem Dreisitzer, erschöpft und mit einem sauren Gesicht, wer weiß, die wievielte Zigarette er gerade rauchte, versunken, so als wolle er sich vor den Aufgaben flüchten, die ihn erwarteten. Beim zweiten Mal, als ich mit dem Koffer an ihm vorbeilief, hob er den Kopf und lächelte mit demselben sauren Gesicht, ohne dass er seine Umgebung wahrnahm. Meine Mutter war derweil damit beschäftigt, die Küchenschränke zu leeren.
Es schien, als wolle sie wirklich gar nichts von der alten Frau behalten. Als sie mich bemerkte, atmete sie schnell durch die Nase ein und aus.
«Mein Kind, würdest wenigstens du nicht so faul sein wie dein Vater.» Wenn sie über ihre Kinder klagte, nahm meine Mutter immer meinen Vater als Beispiel. Ihrer Meinung nach war alles genetisch vom Vater auf uns übergegangen, wenn es um unsere Trägheit, unseren Hedonismus oder unsere morbiden Träume ging. Sie wollte, dass ich die unteren Schränke leere. Als sie den
Koffer in meiner Hand bemerkte: «Geh, schmeiß dieses schmutzige Ding auch in den Flur. Ist der leer?» Sie schnappte mir den Koffer aus der Hand, und als sie bemerkte, dass er leer war, warf sie ihn auf den Boden und machte sich wieder an die Arbeit.
«Es ist so traurig, alles, was diese alte Frau besaß, ist verrottet wie sie selbst. Wer weiß, von wann all diese Schüsseln und Töpfe sind? Aber diese Löffel sehen nach Silber aus. Die kann man weder wegschmeißen noch benutzen. Was, wenn irgendwelche Verwandten kommen – oder der Staat – und nach dem Silber fragen? Am besten schmeißen wir die nicht weg. Kind, warum stehst du immer noch herum?»
Ich stand wirklich so herum. Ich musste verhandeln. Ich war längst zu alt, um bei meiner Mutter durch Weinen etwas zu erreichen. Ich konnte bestenfalls eingeschnappt sein. Aber meine Mutter war kaum in der Lage, das eine oder das andere zu ertragen.
Dass ich ihr den Koffer entwenden konnte, lag an ihrer angespannten Verfassung, sie war zu erschöpft und angewidert zum Streiten. Ich denke aber, sie hat ihn mir überlassen, weil sie sich dadurch das Geld für eine kleine Truhe sparte, die sie mir schon vor Monaten in einem Spielwarenladen versprochen hatte, aber nie kaufen konnte.
Nachdem ich an diesem Abend mit dem Koffer in der Hand in die alte Wohnung wiedergekehrt war, nahm mich meine Mutter nie wieder mit in die neue Wohnung, in die wir zwei Wochen später ziehen sollten, bis sie sie in Schuss bekommen hatte. Die Leute, die die Sachen entsorgten, hatte wieder sie aufgetrieben. Davor hatte sie die Möbel, die noch zu gebrauchen waren, einem Araber gegeben, der Trödler war. Mein Vater hatte zwar darauf bestanden, den Nussbaum-Tisch zu behalten, aber meine Mutter nicht überzeugen können: er war auch darunter.
Als wir zwei Wochen später in die Wohnung zogen, war von der alten Frau keine Spur mehr zu finden. Die schweren, leicht ins Gelbe schlagenden Tapeten mit grünen Blümchen waren weg, die Wände jetzt reinweiß, es war eine sonnendurchflutete Wohnung geworden. Nur das Bild, auf dem der Junge das Mädchen küsste, war an seinen alten Platz gehängt worden, ich vermute, weil es meiner Mutter gefiel. Ach, und natürlich mein Koffer, in dem ich meine schlafende Puppe versteckte, die man mir wegen meines fortschreitenden Alters langsam zum Vorwurf machen könnte, und die Bücher, die ich anfing, mir selbst zu kaufen, die Radiergummis mit dem schönen Geruch, meine Stifte und das beigefarbene Taschentuch mit der Rändelung. Ich öffnete ihn jeden Tag mehrmals und schloss ihn wieder. Ich hatte angefangen, ihn Truhe zu nennen. Mit dem Taschentuch bedeckte ich meine Sachen, bevor ich die Truhe schloss.
Als ich von der dritten in die vierte Grundschulklasse versetzt wurde, erinnerte ich mich häufiger an die alte Frau. Wann hatte sie den Koffer wohl benutzt, vielleicht stammte er auch aus ihrer Kindheit? Es war kein Foto aus ihrer Kindheit gewesen zwischen all denen, die ich weggeworfen hatte. Ich konnte sie überdies weder als Kind noch als Alte denken. Sie war für mich eine schöne, junge Frau, die auf Schwarz-Weiß-Fotos lächelte.
Eines Tages belauschte ich das Gespräch zwischen meiner Mutter und Tante Meryem, die direkt gegenüber wohnte. Die beiden Frauen, die mittlerweile dicke Freundinnen geworden waren, saßen in der geräumigen Küche und tranken Tee, während sie plauderten. Meine Mutter erzürnte sich immer, wenn ich bei den Gesprächen von Erwachsenen dabei sein wollte, und wenn sie sich mit Tante Meryem unterhielt, bekam ich sicher keine Erlaubnis, mich sehen zu lassen.
Meine Mutter war eine findige Frau. Mit ihrer Vitrine, in der schon in der alten Wohnung Kristall-Vasen und Familienfotos ausgestellt waren, hatte sie das Wohnzimmer geteilt, nachdem die schweren Möbel der alten Frau weggeschmissen worden waren. Hinter der Vitrine stand nun ihr Ehebett. In den Raum, der zwischen Vitrine und Wand blieb, hatte sie einen bodenlangen, Faltenvorhang mit Spitzensaum gehängt, so dass ihr Schlafzimmer vom Wohnbereich abgegrenzt
war. Für meinen zwei Jahre jüngeren Bruder und mich hatte sie in dem kleineren Zimmer, dem ehemaligen Schlafzimmer, ein Etagenbett aufgestellt und am Fensterbrett einen Tisch. Mit dem Dreisitzer aus der alten Wohnung und dem alten Wohnzimmertisch mit den Stühlen hatte sie in der Küche ein weiteres Wohnzimmer eingerichtet.
Es war also einer der Momente, an denen ich als klitzekleines Mädchen immer teilhaben und die ich später immer flüchten wollte, als meine Mutter mit Tante Meryem es sich in auf dem Sofa in der Küche bequem gemacht hatte. Knabbereien, die jeden Sommer kiloweise aus der Heimat mitgebracht wurden, Tee und Zigaretten, die meine Mutter vereinzelt rauchte, waren immer dabei. Auf dem Herd der Teekessel mit seinem dampfigen Murren, der Geruch des Suds in meiner Nase; der blutrote Tee in den taillierten Gläsern, die meine Mutter vor einem Jahr ebenfalls aus der Heimat mitgebracht hatte; das wohlige Geräusch knackender Kerne und ihr Gespräch, das zwischen all dem auf- und abwellt…
Entweder hatte meine Mutter nicht bemerkt, dass ich ihnen, das aufgeschlagene Buch vor mir auf dem Tisch, lauschte, oder aber sie dachte, dass ich jetzt in einem Alter war, in dem ich ihnen zuhören durfte. Sie sprachen von dieser Wohnung und der darin gestorbenen Frau.
Tante Meryem gehörte zu denen, die 1961 noch vor ihrem Ehemann gekommen waren. Sie sprach sehr gut Deutsch. Ihr Mann war vor vielen Jahren an Krebs gestorben, und sie hatte nicht wieder geheiratet. Sie hatte ihren Sohn Mehmet, den ich Memo nannte, und ihre Töchter, von denen eine in der Türkei geheiratet hatte und dort geblieben war und die andere – auch wenn sie nicht oft von ihr sprach, obwohl alle es wussten – mit einem Deutschen lebte, allein aufgezogen. Sie war eine lebendige, lustige, dickliche, hellhäutige Frau.
«Weißt du, als die Russen im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal in die Stadt kamen, sollen hier nur Frauen, Alte und Kinder gewesen sein. Alle Männer, die irgendwie eine Waffe benutzen konnten, waren wohl an der Front. Eine alte polnische Frau, die hier mal im Haus wohnte, hat es mir erzählt. Die Soldaten sollen die Frauen wochenlang vergewaltigt haben, sie ließen sie wie Sklavinnen arbeiten. Die zwei Kinder der Frau, die in eurer Wohnung gewohnt hat, sollen durch die Bomben getötet worden sein. Und ihr Mann kehrte von der Front nicht zurück. Obwohl fast vierzig Jahre vergangen waren, hat die Frau bis zu ihrem Tod niemandem die Tür geöffnet. Mein Mehmet war damals ein kleiner Junge, manchmal half er ihr, die Einkaufstaschen nach oben zu tragen, selbst mit ihm sprach sie nur ganz ängstlich und zurückhaltend. Fünfzehn Jahre war sie meine Nachbarin, aber sie hat mich nur einmal in ihre Wohnung eingeladen. Das sollte wahrscheinlich ein Dank sein für die vielen Male, die Mehmet ihr geholfen hatte. Ich ging mit Mehmet hin. Sie hatte dem Jungen ein Brot belegt, mit Käse, und darunter so ein Fingerhoch Butter. Dem Jungen wurde ganz schlecht. ‹Ach›, beklagte sie sich, ‹wüssten Sie nur, wie es hier nach dem Krieg war, ich habe jahrelang mit der Sehnsucht nach einem so dick mit Butter bestrichenen Brot gelebt.›
Na ja, als die Russen kamen und an jede Tür klopften und alles durchsuchten, hat sich diese Frau wochenlang unter ihrem Bett versteckt. Die Polin meinte, die russischen Soldaten, die eher aus ländlichen Gegenden kamen, wollten nicht höher als in den dritten Stock steigen. Sie waren es wahrscheinlich nicht gewohnt, höher zu steigen. Und ein Teil der Treppe war wohl auch eingestürzt, also kam keiner hier hoch, weil sie dachten, da ist eh niemand mehr.»
Meine Mutter hörte mit großem Interesse zu und kommentierte gelegentlich mit «Oh… Ach… Nein!»
«Weißt du, die waren nicht immer reich, dieses Volk hat viel Armut erlitten. Sie sagen, es habe monatelang kein fließendes Wasser gegeben, und zu essen gab es auch nur wenn der Herrgott sich erbarmte. Wie auch immer diese mitleiderregende Frau es hier wochenlang ohne Wasser und etwas zu essen ausgehalten haben mag… Sie hat uns jahrelang nur ganz ängstlich durch den
Türspalt angesehen. Man sagt doch, dass die Alten fremdenfeindlich sind, dass sie rassistisch sind… Ich glaube, diese Frau war nicht feindlich, sie fürchtete sich nur, dass jemand plötzlich in ihre Wohnung drängen könnte. Die Arme ging in letzter Zeit nicht einmal mehr vor die Tür.»
Ich hielt es nicht mehr aus und mischte mich ins Gespräch. Mir war eine alte Frau eingefallen, die im Haus gewohnt hatte, aus dem wir weggezogen waren; sie hatte immer einen stahlharten, hasserfüllten Blick, der mir einen Schrecken einjagte. Sie war immerzu in einer Verteidigungshaltung, ihren Gehstock hielt sie stets aufrecht, so als wollte sie damit im nächsten Augenblick jemandem ins Gesicht schlagen. «Mama, unsere alte Nachbarin, Frau Schiffer, die mit dem weißen Hund. Sie war auch so. Sie nannte mich immer Türken-Göre.»
Meine Mutter schickte mich sofort auf mein Zimmer, nachdem sie mich erst bemerkt und dann beschimpft hatte, weil ich ihnen lauschte.
Draußen der unaufhörliche Regen, drinnen mein Bruder, der sich unter dem Vorwand, Fußball zu schauen, auf den Boden vor meinem Vater ausgestreckt hatte und döste. Ich gehörte also noch nicht zur Erwachsenenwelt. Als ich in mein Zimmer ging und meinen Koffer auf den Schoß nahm, bereute ich zum ersten Mal, dass ich die Sachen der Frau weggeworfen hatte. Vielleicht hatte sie in diese Hefte geschrieben, wie sie sich vor den Russen versteckt hatte.
Mit den Jahren vergaßen wir die Frau, die in dieser Wohnung gewohnt hatte. Weder Tante Meryem noch meine Mutter, niemand sprach mehr von ihr. Ich hingegen dachte jedes Mal an sie, wenn ich immer mal wieder meine Truhe öffnete, in die ich mit den Jahren alles Mögliche tat und deren Inhalt unaufhörlich wechselte. Aber mit der Zeit vergaß auch ich sie. Sie verschwand ganz und gar aus meinem Leben, nachdem ein Spiegelschrank mit Schubladen in unser Zimmer gezogen war, wie auch die Truhe ihren Zauber verloren hatte. Je älter ich wurde, desto mehr wurde sie zum alten Koffer, der irgendwo auf dem Schrank einen Platz hatte, ein gewöhnlicher Gegenstand, der durch andere ersetzt werden konnte, wenn er abgenutzt war. Nachrichten von Frauen, die tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurden, bedeuteten mir nichts mehr. Das Leben änderte schnell sein Gesicht. Ich wurde größer und meine Interessen und Begeisterungen in Bezug auf die Außenwelt wechselten; meine Aufmerksamkeit richtete sich auf andere Weise auf mich selbst, auf meinen eigenen Körper. Oder aber das Mitleid, das ich für diese Frau empfunden hatte, war verblasst angesichts der Dinge, die ich viel später über die Vergangenheit lernte. Ich hatte nie bewusst darüber nachgedacht, was ihre Rolle in der Geschichte gewesen sein mochte, dass ihr kleines individuelles Delirium ein Teil des Massendeliriums gewesen sein mochte, das zu einer großen Vernichtung geführt hatte. Vielleicht hatte sie durch den Türspalt gar nicht ängstlich auf Fremde geguckt, sondern mit einem Ekel, der für ihren Anteil an einem gemeinschaftlichen Verbrechen stehen konnte, für eine riesige Weltsicht, die von sich so verzaubert war, dass sie sich in sich verschloss und zum Grund für dieses Verbrechen wurde. So hatte ich nie darüber nachgedacht. Man glaubte also das, was man am nächsten sah, was einem aus vertrautem Mund erzählt wurde.
Was versprach nicht so ein klitzekleiner Koffer mit braunem Grund, die Außenwände verziert mit bräunlichem Geschlinge, die inneren grün gesäumt, einem achtjährigen Mädchen, das seinen Glauben an Märchen noch nicht verloren hatte, die immer noch hing an Truhen, verschlossenen Kästchen und einer Welt, die in Zauberlampen verborgen war… Alles Gute und alles Schlechte kam und verschwand noch mit Magie und Zauber; die Geschichte selbst bestand allein aus dem guten Herzen von schönen Prinzessinnen mit langem, lockigem Haar und von verschrumpelten Zauberinnen mit langen, warzigen Nasen.
Es muss um das fünfzehnte oder sechszehnte Lebensjahr herum gewesen sein, dass ich meine Beziehung zu dem kleinen Koffer ganz und gar beendete. Es ist sehr erstaunlich, dass ich von seinem weiteren Verbleib nichts mehr weiß, wenn man bedenkt, wie klar ich mich an den Tag erinnere, an dem ich ihn zuerst sah, und auch an das Gefühl, das er in mir erzeugte. Gänzlich
unklar ist mir, wie er in diesen Bunker gekommen sein könnte, der in ein Museum umgewandelt wurde und nun das Leben in der Stadt zwischen den Jahren 1940 und 1945 zeigt, als sie bombardiert wurde. Er ist voll mit Sachen aller Art.
Der großgewachsene blonde Mann, der uns führt, hat von den Gläsern abgelassen, die aus einer bombardierten Gaststätte stammten, und auch von den Geschichten der hier geborenen Menschen, in deren Geburtsurkunden der Name dieses Luftschutzkellers steht und die heute in ihren Sechzigern sind, und wendet sich der Belüftungsanlage zu.
«Ein Luftschutzkeller, der so tief liegt, war für einhundert Menschen ausgelegt und bot Sauerstoff für zwei Stunden. Zum Ende des Krieges hin mussten hier aber mehr als fünfhundert Menschen für mehrere Stunden die Luft anhalten.»
– Ich aber höre gar nicht zu. Ich bin in diesem Luftschutzkeller, den ich in der Neugier betreten habe, eine dunkle Epoche auch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, nach Jahren des Forschens, der vielen Erzählungen und Spielfilme und zahlloser Schwarz-Weiß-Dokumentationen – ausgerechnet meiner eigenen Kindheit begegnet. Ich vergaß die anderen fünfundzwanzig Personen, die mit mir die Eintrittskarte gelöst hatten und in den alten Luftschutzkeller in einem U-Bahnhof hinabgestiegen waren; und war allein mit meinem kleinen Koffer, der nichts von seiner Art und seiner Farbe verloren hatte. Ich vernahm das Murmeln des Teekessels, der langsam in der Küche köchelte, und den dampfigen Geruch des Teesuds.
Bitte nicht berühren, sagt der Museumsfüher, sodass ich wieder zu mir komme. «Wir haben jahrelang viel Mühe darauf verwandt, diese Sachen zusammenzutragen. Es sind alles wichtige zeitgeschichtliche Dokumente.»
Ich ziehe schnell die Hand von dem eisernen Schloss, dessen Klicklaut ich höre, obwohl ich es nicht geöffnet habe, während ich mit den Fingern darüberstrich.
«Was sind das für Koffer? Wissen Sie zum Beispiel, wem dieser hier einmal gehört hat?»
«Nein, manche der Koffer hier sind auf Dachböden gefunden und weggeworfen worden, andere sind Trödlern gegeben worden, die meisten aber befanden sich in solchen Kellern und haben sich so bis heute erhalten. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie bemerken, dass sie alle sehr klein sind. In den letzten Jahren des Krieges mussten die Menschen jederzeit mit Fliegeralarm rechnen und haben ihre nötigsten Dinge immer mit sich herumgetragen, sie haben diese Koffer tagsüber zur Arbeit mitgenommen. Der, den sie da haben, erinnert an eine schmale Truhe und hat eine wichtige Besonderheit. Er wurde aus Eiche gefertigt, für Überseereisen, der kleinste aus einem Vierer-Set aus den 20er Jahren. Er ist besonders gut geeignet für die kleinen privaten Dinge von Kindern und Frauen. Er sieht doch schön aus, oder? Eigentlich ein sehr besonderes Antiquitätenstück. Er müsste einer jungen Frau gehört haben. Ich habe ihn bei einem Trödler entdeckt, ich glaube, es war ein arabisches Geschäft. Der Ladenbesitzer wusste nur, dass er einmal einer Frau gehört hatte, die vor Jahren allein in ihrer Wohnung gestorben war.»
Der Führer zeigte auf die Wand, die mit Bildern, Fotos, Dokumenten und Zeitungsausschnitten vollgehängt war: «Sehen Sie, das beigefarbene Taschentuch in Nummer 136 hat sich auch darin befunden.»
Ich nähere mich der Wand. Ich erkenne sofort mein Taschentuch. Mit der alten Rändelung; das Rosenmotiv mit den grünen Blättern, die erste Stickerei, die ich beherrschte, ist etwas verblasst. Das Rosenmotiv war mir nicht schwergefallen, wohl aber das Anbringen dieses kleinen Stück Gitterstoffs auf dem Taschentuch und dann, nachdem das Motiv auf dem Tuch war, das Rausziehen der einzelnen Fäden.
«Ich vermute, dass der Koffer und das Taschentuch in dieselbe Zeit und sogar derselben Person
gehört haben. Sehen Sie das Motiv in der Ecke, das eine Rose andeutet? Während das Taschentuch, also der Stoff und die Rändelung in die 1930er oder 1940er gehören, ist das Stickmotiv jüngeren Datums.» Der Mann schweigt eine Weile. «Und dann waren noch einige Briefe im Koffer, die in dieses Taschentuch gewickelt waren. Daran erinnere ich mich sehr gut, denn die Briefe sind in das Tuch gewickelt und dann unter das Futter geschoben worden. Oder vielleicht sollte ich sagen: versteckt worden, denn die Naht des Futters war feinsäuberlich gerade so weit geöffnet worden, dass die Briefe durchpassten.
Briefe?
Ich dachte, ich spreche mit mir selbst, aber ich muss nur laut gedacht haben, der Führer führt fort.
«Ja, ich vermute, es waren Liebesbriefe. Aber sie hatten nichts mit der Tasche und nichts mit der Zeit zu tun, wir haben sie weggeworfen.»
Sie haben sie weggeworfen. Gut, aber gibt es einen Unterschied zwischen Vergessen und Wegwerfen?
Plötzlich habe ich die Vergangenheit wieder vor Augen, es fällt Licht auf sie. Meine ersten entzückenden Entdeckungen, so schmerzlich sie waren und so ängstlich ich war, in der Zeit, als ich mich meinem sich verändernden Körper zuwandte und begann, die Dinge in meiner Umgebung weniger wichtig zu nehmen. Dort hatte ich also, als ich fünfzehn war, die Liebesbriefe von Peter versteckt? Jahre später hatte ich mich an sie erinnert und danach gesucht, sie aber nicht finden können. Vor allen hatte ich sie fest verstecken wollen, ich hatte Angst, dass meine Mutter sie entdecken würde, aber wollte sie auch nicht wegwerfen. Die Möglichkeit, die mir blieb, war das Versteck unter dem grünen Futter, das ich vorsichtig löste, um die Briefe auf der Unterseite des Koffers zu verstecken, mein erstes Einundalles, meine ersten Liebesbriefe hatte ich vergessen.
Sehen sie nach mir? Es sind fast zwanzig Jahre vergangen seitdem, haben sie bemerkt, dass mein erstes fiebriges Liebesabenteuer wiederauflebte? Dass ich mit der Trauer und Begeisterung weinte, wieder in die Kindheit, in die Vergangenheit gereist zu sein? Ich trockne meine Augen mit dem Papiertaschentuch, das ich aus meiner Tasche nehme, und sehe mich um. Die Gruppe hat sich um eine Wiege versammelt, die für ein Neugeborenes bestimmt ist. Es ist eine Gasmaske dran. Die Gesichtsausdrücke sind verlegen und benommen. Würde es diese Menschen enttäuschen, wenn ich ihnen sagte, dass dieses Taschentuch da und die Tasche eines Tages mir gehört hatten? Menschen, die in diesen Gegenständen, wer weiß, ihre eigene dunkle Geschichte suchen. Eine schmerzvolle Geschichte, die, immer wenn sie zur Sprache kommt und sie gewahren, dass sie selbst Täter des Schreckens hätten sein können, darauf angewiesen ist, von der Komplizenschaft mit dem Schrecken befreit zu werden. Aber es kümmert sich niemand, weder um mich noch um die zwei gestickten rosafarbenen Rosen, meinem ersten amateurhaften Versuch mit der Stickerei.
Über das schmale Treppenhaus verlassen wir den Luftschutzkeller und kommen ans Tageslicht. Die Gesichter sind blass, die Augen umnebelt. Die in Gedanken versunkenen Menschen verteilen sich in alle Richtungen. Bei manchen fällt auf, dass sie aufatmen, so als würden sie sagen wollen, das war eben ein Museumsbesuch und der ist jetzt zum Glück vorbei. Ich hingegen bin immer noch benommen und weiß nicht, wohin. Ist es aber am Ende nicht ein Eintritt, mit einem Ticket? Ich kann noch tausende Male hierherkommen und erneut auf eine Reise in meine eigene Vergangenheit gehen, solange, bis es mir gar nichts mehr bedeutet.
Aus dem Erzählband «Valizdeki Mektup» (Der Brief im Koffer, YKY, 2007)
Aus dem Türkischen übertragen von Koray Yılmaz-Günay für den Zeitschrift „freitext/Kultur-und Gesellschaftsmagazin, Heft 19, April 2012“
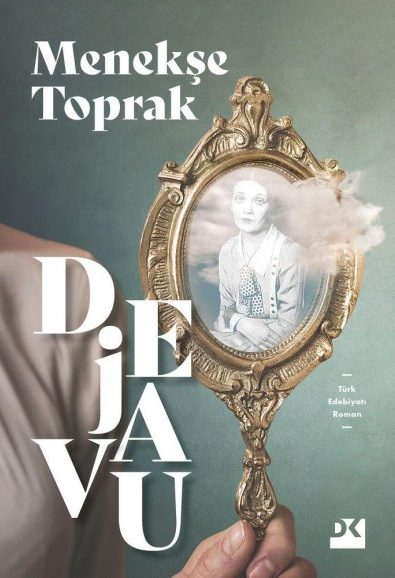




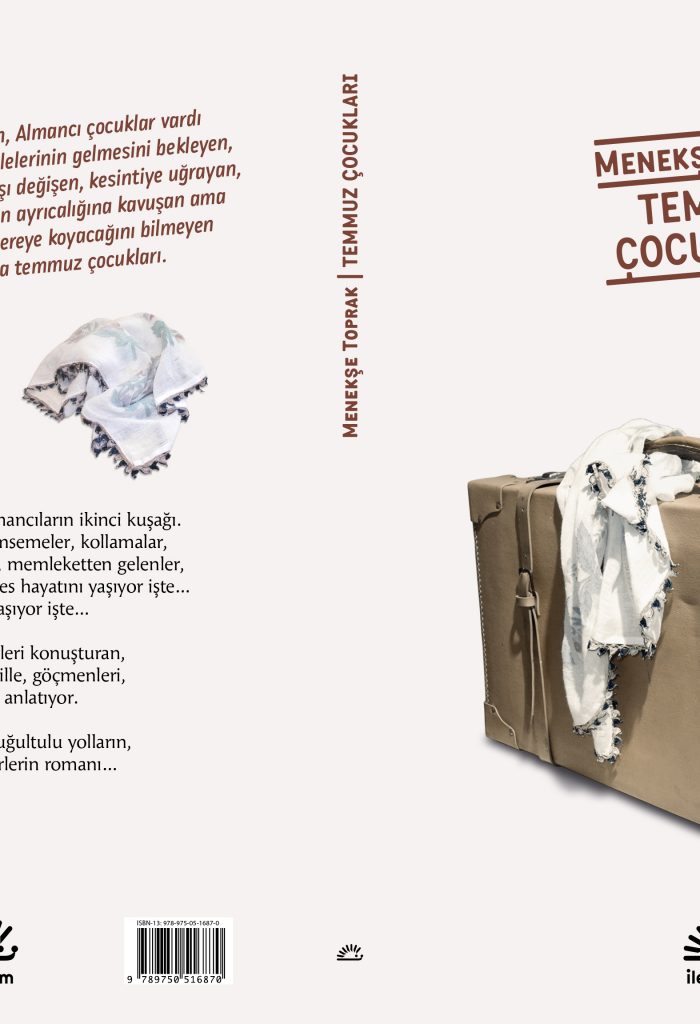

Die Kommentarfunktion wurde geschlossen, aber Trackbacks und Pingbacks sind noch offen.